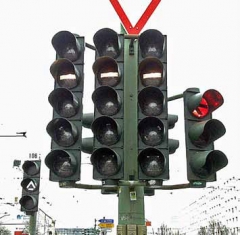 |
| Lichtsignalanlage für Straßenbahnen Landsberger Allee Ecke Petersburger Straße. Der waagerechte Balken bedeutet „Halt“ – ein Signalbild, das die Straßenbahn allzu oft sieht. Foto: Marc Heller |
|
Immer wieder kann der Berliner
folgendes Phänomen beobachten:
Zugezogene oder Besucher
loben das Fahrplanangebot, über
das der Berliner gerne meckert,
aber sie wundern sich darüber,
dass hier die Straßenbahnen nicht
nur an den Haltestellen, sondern
auch an fast allen Lichtsignalanlagen
(LSA) halten. Darüber sieht
wiederum der Berliner mehrheitlich
resigniert hinweg, während
Auswärtige das aus ihrer Heimat
meist nicht kennen, denn dort
wird eine Straßenbahn-Vorrangschaltung
ihrem Namen auch gerecht!
Als sich die Berliner Verwaltung
nach den großen (finanziellen)
Erfolgen in anderen Städten mit
dem Vorrang für Bahn und Bus
befassen musste, wurde durch
eine komplizierte Planungs- und
Genehmigungsstruktur schon
der erste Bremsklotz gegen einen
Erfolg gelegt. Die BVG als größter
Nutzer der meisten Verkehrsknoten
kann lediglich Anträge stellen, weder gehören
ihr die Lichtsignalanlagen noch darf
sie Programme dafür schreiben. Auch wenn
wegen Fehlern oder Bauarbeiten eine Vorrangschaltung
wieder außer Betrieb gesetzt
wird, dann darf die zuständige Stelle das sofort
und ohne Absprache tun. Das Wiederin-
Betrieb-Setzen dagegen wird später oft
vergessen – und die BVG muss einen neuen
Antrag stellen.
Nur die BVG muss zahlen
Der zweite Bremsklotz gegen den ÖPNV
ist die Finanzierung der neuen Schaltungen.
Während die Belange aller anderen
Verkehrsteilnehmer ohne extra Obolus berücksichtigt
werden, soll die BVG für eine
moderne Förderung des elektrischen Verkehrs
einen Vorschuss geben. So begann
das Straßenbahn-Vorrangprogramm in den
1990er Jahren mit vielen Millionen D-Mark
vom Verkehrsbetrieb an die Stadt. Ein Witz!
Insbesondere dann, wenn man bedenkt,
dass die BVG auf Gelder des Senats angewiesen
ist, um überhaupt arbeiten zu können.
Sie sollte also einen Teil der Zuschüsse
an ihren Geldgeber zurückzahlen, um das
zu bekommen, was für andere Nutzer gratis
ist – beispielsweise „Grüne Welle“ und
fußgängerfreundliche Kreuzungen.
Wegen dieser zwei großen Nachteile hat
die Straßenbahn in Berlin täglich einen Papierkrieg
mit der Verwaltung der Stadt zu
führen, nur um den Regelbetrieb am Laufen
zu halten. Da auch bei der BVG gespart
werden muss, ist der zusätzliche Aufwand
für lediglich vorübergehende Straßenbahnvorrangschaltungen
z. B. aufgrund von Baustellen
oder Großveranstaltungen (zu denen
dann die BVG zur Anreise empfohlen wird!)
oft nicht zu schaffen. Nach etlichen Frustrationen
dürfte sich der Elan der BVGer in
Grenzen halten.
Auch für das Fahrpersonal gibt es in der
gegenwärtigen Konstellation nur wenige Erfolgserlebnisse,
wenn der vorgeschriebene
Meldeweg für defekte Ampelschaltungen
allzu oft ins Nirwana führt und keine Besserung
des Missstandes erkennbar ist.
 |
| Das Thema „fehlende Bevorrechtigung von Straßenbahnen“ war schon Titelthema im SIGNAL 4/2011. GVE-Verlag |
|
Verwaltungsstruktur behindert
Vorrangschaltungen
Gegenwärtig sieht die Verwaltungsstruktur
für Lichtsignalanlagen so aus: Der Senat als
Eigentümer setzt seine landeseigene Behörde
„Verkehrslenkung Berlin“ (VLB) für die
Planung und Genehmigung ein, diese betreibt
ein Verkehrsregelungszentrum (VKRZ)
für das operative Geschehen, das direkten
Zugriff auf alle LSA hat. Die VLB hat zurzeit
einen langfristigen Vertrag für Wartung und
Betrieb der LSA mit einem Generalübernehmer
(GÜ), der als privates Unternehmen im
Auftrag der VLB, also des Landes Berlin, aber
mit Erwartung eines Profits, die Wartung
und Programmierung der Ampeln untervergibt.
Wenn die BVG eine Schaltung zum Sparen
von Energie und Fahrzeit haben möchte,
dann muss sie sich an den GÜ oder direkt
an das von diesem benannte Planungsbüro
wenden. Wenn den Vertragsfirmen
dadurch zu viel Arbeit
entsteht, dann werden die BVGAnliegen
nochmals an Subunternehmer
weitergereicht. Nach
Abschluss der Planung wird das
Programm der VLB zur Prüfung
vorgelegt, die die Belange der
anderen Verkehrsteilnehmer oftmals
wieder weiter nach oben
rückt. Entsprechend muss dann
das Programm nochmals umgeschrieben
werden. Verständlich,
dass auf diesen Wegen schon mal
der ursprüngliche Gedanke verloren
gehen kann. Trotzdem darf die
BVG dann im Gegensatz zu allen
anderen Nutzern der LSA dafür
bezahlen.
Zusatzkosten für Fahrzeuge
und Personal
Das Ergebnis dieser straßenbahnfeindlichen
Politik fällt, wie eingangs
beschrieben, nicht nur den
verkehrlichen Laien beim Berlin-
Besuch auf, sondern schlägt sich
jeden Tag negativ im finanziellen
Ergebnis der BVG und im Ansehen des gesamten
ÖPNV in Berlin nieder. Lassen sich
die Zusatzkosten für Planzüge und Personal,
auf die man mit Vorrang verzichten könnte,
noch exakt beziffern, so sind die Imageschäden
leider rechnerisch kleiner, aber langfristiger
wirksam. Da die Lage für Autofahrer in
Berlin auch im Berufsverkehr immer noch
entspannt ist, entsteht bei Tramfahrgästen,
die an der Ampel warten, schnell der Eindruck,
dass es besser ist, statt auf einem
Stehplatz in der Bahn auf einem Sitzplatz im
Auto die Zeit zu verbummeln.
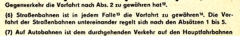 |
| Es gab mal eine Zeit, da hatte die Straßenbahn noch uneingeschränkte Vorfahrt. Straßenverkehrs-Ordnung der DDR 1977 |
|
Hinzu kommt die dadurch mitverursachte
Unpünktlichkeit, die bei jedem verpassten
Anschluss für weiteren Zeitverlust gegenüber
dem Auto sorgt und gerade bei Herbstund
Winterwetter zu starker Verärgerung
selbst der besten Stammkunden führt. Diese
vermeidbaren Nachteile durch die unzulängliche
Förderung des Umweltverbundes
führen schon bei noch nicht führerscheinfähigen
Jugendlichen zu falschen Anreizen
in der Verkehrsmittelwahl der Zukunft – die
Straßenbahn verliert also schon heute ihre
Kunden von morgen.
VLB bremst Straßenbahn
Das Hauptargument der VLB gegen einen
wirklichen Vorrang der Straßenbahn lautet
stets: Dann sind LSA-Umläufe an Kreuzungen
für alle anderen Verkehrsteilnehmer
nicht mehr berechenbar und damit könne
Dauerrot für bestimmte, die Straßenbahn
kreuzende Verkehrsströme entstehen. Das
ist natürlich Unsinn: Erst mit einem wirklichen
Vorrang der Straßenbahn wird diese
berechenbar, sie kommt dann nämlich genau
nach Fahrplan und nicht mehr zufällig!
Und die meisten Ampeln stehen an Strecken
mit maximal 5 Minuten Zugfolgezeit. Rein
rechnerisch kommt in beiden Richtungen
alle zweieinhalb Minuten eine Tram, was bei
LSA-Umlaufzeiten von 70 bis 100 Sekunden
nur jeden zweiten Umlauf überhaupt berührt.
Dieses unqualifizierte Argument zeigt
auch, dass der Weg Berlins zu dem selbsternannten
„Verkehrskompetenzzentrum“
noch sehr weit ist – insbesondere wenn man
bedenkt, dass die Straßenbahn ein wichtiges
Stück der zukunftsfähigen Elektromobilität
ausmacht und darum besondere
Förderung verdient. Für alle Verwalter des
täglichen Elends auf den Schienen dieser
Stadt ins Stammbuch:
- Nicht-motorisierter Verkehr ist stets menschen-
und umweltgerechter als motorisierter
Verkehr,
- Öffentlicher (motorisierter) Verkehr ist
stets besser als motorisierter Individualverkehr
(MIV),
- ÖPNV lässt sich am leichtesten
und billigsten elektrifizieren
und damit gegen die
Energiekrisen der Zukunft
wappnen – die Straßenbahn
sollte also gesondert
gefördert werden!
Diese Erkenntnisse sind nicht
neu und so in jedem Lehrbuch
zu diesem Thema zu
finden.
Kein Vorrang für Tram und
Bus in Berlin
Eigentlich kann vom Vorrang
für die Straßenbahn in Berlin
gar nicht die Rede sein, aber
es gibt einige Strecken und
Knotenpunkte, die in dem
Meer der Unzulänglichkeiten
noch negativ auffallen.
Vorrang würde bedeuten,
dass der Straßenbahnfahrer
niemanden an der Haltestelle zurücklassen
muss, um eine Freiphase zu schaffen und
dann ohne weiteres Anhalten oder auch nur
Bremsen bis zur nächsten Haltestelle fahren
kann. Vorrang heißt natürlich auch, dass
andere Verkehrsteilnehmer (z. B. der MIV)
Nachrang haben und warten müssen. Diese
Konsequenz darf einem Programm nicht als
Fehler ausgelegt werden, denn sie stellt den
Preis der Bemühungen dar.
Die Metrolinien M 1 und M 2 sind hier
die kritischsten Kandidaten, wobei die M 1
noch unter einer schlechten Erreichbarkeit
der Züge an den Haltestellen leidet, weil sie
ohne schützende und erhöhte Haltestellenkaps
mitten auf der Straße halten. Zusätzliche
Verlustzeiten durch die Hubliftbenutzung
sind so vorprogrammiert.
Auch die M 4 wurde in letzter Zeit wieder
verschlechtert, etliche Schaltungen
entlang der Greifswalder Straße erhielten
verkürzte Phasen für die Tram oder Anforderungsschaltungen,
vor denen der Zug
immer erst zum Halten kommen muss, bevor
die Freigabe erfolgt. Auf dieser Linie
wie auch auf der M 6 und M 13 sind die Fußgängerfurten
von besonderer Bedeutung (siehe unten).
Im Raum Köpenick ist speziell die LSA am S-Bahnhof
Adlershof überarbeitungsbedürftig.
Weitere neugebaute Ampeln mit Straßenbahnbremse
sind die in der Rhinstraße südlich
der Landsberger Allee (IKEA-Zufahrt)
und die Ausfahrt der M 10 am Nordbahnhof:
Dort ist es offenbar ausgeschlossen, dass
zwei sich begegnende Züge gleichzeitig
Fahrt erhalten – dabei wäre so eine Möglichkeit
sogar für den wartenden Autoverkehr
besser! Selbstverständlich bedeutet auch
dort eine angezeigte Anforderung nicht,
dass schnell eine Freigabe erfolgt, sondern
Wartezeiten bis zweieinhalb Minuten sind
möglich. So beginnen viele Fahrten
auf der ampelreichsten Tramlinie Berlins
schon mit Verspätung.
Besondere Spezialität sind in Berlin
offenbar wichtige Kreuzungen, für die
seit Jahren entweder fertige Programme
vorliegen, aber nicht umgesetzt werden
(so zum Beispiel beide Anlagen am
Mollknoten: Ecke Prenzlauer Allee und
Ecke Otto-Braun-Straße) oder für die
Programme von der BVG angefordert,
aber von anderen Stellen torpediert
wurden (Wilhelminenhof-/Edisonstraße).
Gefährliche Schaltungen an
Fußgängerüberwegen
Ein typisches, nicht ortsspezifisches Beispiel
ist die Schaltung von separaten Fußgängerüberwegen.
Hier kommt es oft vor,
dass die schon geschaltete Fahrtphase für
die Tram zurückgenommen wird, wenn sich
ein Zug nähert. Hektische Bremsmanöver
mit der Gefahr der Verletzung in der Bahn
stehender Kunden und eine Verzögerung
von mindestens 30 Sekunden für mehrere
hundert Fahrgäste sind der Preis für ein bis
drei Fußgänger, die so etwa 10 Sekunden
sparen. Solche Schaltungen gehören generell
verboten. Wenn eine Freiphase für
eine sich nähernde Bahn geschaltet ist, darf
sie ohne Notfall nicht mehr zurückgenommen
werden! Eine Lösung des Problems
in Form von Vorsignalen gab es schon an
vielen Stellen in Berlin, wurde aber wieder
abgeschafft.
Neben der teuren und technisch aufwändigen
Lösung an LSA darf nicht übersehen
werden, dass auch die StVO noch Spielräume
pro Straßenbahn bietet. Ein genereller
Vorrang an Kreuzungen ohne Ampel und
eine stärkere Ahndung und höhere Strafbewehrung
gegen Behinderung des ÖPNV wären
ein deutliches Zeichen des Gesetzgebers
für eine zukunftsorientierte Verkehrspolitik;
selbst die StVO der DDR war da weiter. Im Paragraph
13 Abs. 6 hieß es: „Straßenbahnen
ist in jedem Falle die Vorfahrt zu gewähren.
Die Vorfahrt der Straßenbahnen untereinander
regelt sich nach den Absätzen 1 bis 5.“ IGEB Stadtverkehr
|

