 |
Bis 1990 waren die Hauptverdienstquellen
der Einwohner des Thüringer Waldes neben
dem Tourismus Holzwirtschaft, Herstellung
von Spielwaren und Glasgeräten, Porzellanindustrie
und ein wenig Bergbau und Eisenverarbeitung.
Nach der Wende brachen in dieser
sowieso schon immer strukturschwachen Region
die bisherigen Beschäftigungsmöglichkeiten
fast vollständig weg. Holz kam aus Übersee,
Spielzeug, Glas und Porzellan wurden
bereits woanders konkurrenzlos billiger hergestellt.
So blieb letztlich nur der Tourismus
als ernstzunehmende Einnahmemöglichkeit
für Menschen und Kommunen übrig. Ausgedehnte
Wanderwege, eine sagenhaft schöne
Natur und gepflegte Wintersportgebiete bilden,
zu DDR-Zeiten wie jetzt, ein Pfund, mit
dem es zu wuchern galt und gilt!
In dieser Gegend liegt nun der Preisträger
des Deutschen Schienenverkehrs-Preises
2003 in der Rubrik Kultur. 2002, pünktlich
zum 80-jährigen Bestehen der Standseilbahn,
wurde sie frisch saniert und als Mittelstandsoffensive
der Deutschen Bahn AG wieder in
Betrieb genommen.
 |
| Ab Rottenbach fahren die Triebwagen der OBS über Obstfelderschmiede nach Katzhütte. Foto: Frank Böhnke |
|
Das relativ unzugängliche Gelände ließ keine
Verkehrserschließung mit großzügigen
Schnellstraßen und Autobahnen zu. Der Thüringer
Wald und das Thüringer Schiefergebirge
(geologisch korrekt handelt es sich nämlich
um zwei Gebirge, die ineinander übergehen)
mit seiner Länge von etwa 130 Kilometern
weist große Höhenunterschiede auf geringer
Entfernung auf. Da hatten Planer immer
Schwierigkeiten, mit ständig knappem Geld
günstige Verkehrsverbindungen herzustellen.
Große Umwege und viele Kunstbauten waren
erforderlich; für den An- und Abtransport von
Rohstoffen und Fertigwaren war das ganze
eine ziemlich teure Angelegenheit und somit
eigentlich uninteressant. Und im Winter, wenn
tiefer Schnee lag, war ein Erreichen der kleinen
Dörfer mitunter eine Angelegenheit von
mehreren Stunden.
 |
| Cursdorf ist ein geeigneter Ausgangspunkt für Wanderungen und Spaziergänge. Foto: Frank Böhnke |
|
1872 bereits gab es Planungen für eine Eisenbahn,
damit die Holz-, Glas- und Porzellanindustrie
in der Region gehalten werden
konnte. Die Produktion war das eine, irgendwie
mußten die Waren auch abtransportiert
werden. Da kam als zuverlässiges und leistungsfähiges
Transportmittel nur die Eisenbahn
infrage. Umfangreiche Studien, wie denn
die Streckenführung durch das enge und verschlungene
Schwarzatal aussehen könnte und
an das übrige Eisenbahnnetz Anschluß finden
könne, wurden in Auftrag gegeben, durchgerechnet,
geändert, verworfen und abgelehnt.
Fast alle Projekte sahen die Untertunnelung
des Thüringer Waldes vor; das war (damals!)
technisch und finanziell nicht leistbar. Auch
mit anderen unüberwindbaren Schwierigkeiten
hatten die Planer damals zu tun: das Projekt
der privaten Aktiengesellschaft „Comittee
Schwarza-Eisenbahn" scheiterte, weil es
eine Streckenführung durch das Jagdgebiet
des Grafen von Schwarzburg-Rudolstadt vorsah
- undenkbar.
Seit 1816 war die Region Oberweißbach
Provinz des Staates Preußen und, sicherlich
aus militärischen Gründen, hatte dieser als
aufstrebende Macht ein Interesse an dem Bau
der Eisenbahn. Im April 1895 kam die Anordnung
zum Bau per Kabinettsorder. Die Jagdansprüche
des Herrn Grafen hatten sich den
staatlichen Zwängen unterzuordnen. Zwar
konnte er durch taktieren den Baubeginn
noch um weitere fünf Jahren hinausschieben,
zum Verhindern war es zu spät. Am 18. Dezember
1900 fuhr der erste Zug von Rottenbach
nach Katzhütte, dem Endbahnhof der
Schwarzatalbahn. Der Weiterbau von Katzhütte
nach Großbreitenbach blieb jedoch immer
nur ein Projekt.
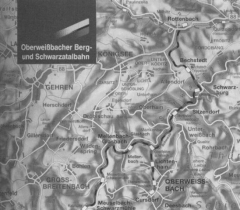 |
| Im Bahnhof Rottenbach beginnt die Schwarzatalbahn, die im Haltepunkt Obstfelderschmiede (etwa auf der Hälfte der Strecke zum Endpunkt Katzhütte) Anschluß an die Standseilbahn nach Lichtenhain hat. Nach der Fahrt mit der Standseilbahn wird im Bahnhof Lichtenhain in die Triebwagen der Flachstrecke umgestiegen. Nach einer weiteren Station wird der Endpunkt Cursdorf erreicht. Für alle drei Schienenverkehrsmittel gibt es natürlich einen Fahrschein. Karte: OBS |
|
Im Haltepunkt Obstfelderschmiede beginnt
die Strecke der Standseilbahn. Der schmucke
Bahnhofsbau präsentiert sich in Holzbauweise.
In der Fahrkartenagentur gibt es Andenken
und Souvenirs, natürlich Fahrkarten und Wandertipps.
Am Hang steht bereits der Bergbahn-
Wagen abfahrbereit. Je nachdem, welchen
der beiden Wagen man vor sich hat, ist
man entweder von der Wagenbreite oder von
der gesamten Konstruktion fasziniert. Der
Personenwagen hat eine Breite von vier und
eine Länge von knapp zehn Metern und wirkt
klobig. Durch seine Rundumverglasung und
die Farbgebung erholt sich der Betrachter
schnell von dem fremden Anblick. Fährt man
mit dem Aufsetzwagen, muß man sich dieses
Gefährt wörtlich vorstellen: ein Huckepack
genommener Eisenbahnwagen. Der Wagen
fährt auf der Bühne mit, ist zwar gesichert,
könnte aber an beiden Enden auf dem Normalspurnetz
weiterfahren. Hierin liegt nun die
Besonderheit der OBS. Gedacht war die ganze
Anlage ehemals nämlich nicht für den Touristenverkehr,
sondern für den Warentransport.
Oberweißbach-Deesbach und Cursdorf erhielten
so Anschluß an das Staatsbahn-Netz und
der Transport der dort hergestellten Güter
war kein Problem mehr. Sowohl Tal- als auch
Bergstation verfügen über den besagten Eisenbahn-Anschluß
und komplette Güterwagen
waren in Obstfelderschmiede, der Talstation,
ohne große Probleme auf den Aufsetzwagen
huckepack genommen und in der Bergstation
schnell auf „eigene Beine" gestellt. Diese
damals wie heute geniale Kombination macht
die OBS so einzigartig und interessant - auf
keiner anderen Bergbahn können normalspurige
Eisenbahnwagen verladen werden.
Am 8. Februar 1922 ist es soweit: der offizielle
Verkehr wird aufgenommen; nicht jedoch
für den Personentransport, sondern erst für
Güterwagen, für den Frachtgutverkehr wie
dies damals hieß. Nach den verfügbaren Unterlagen
folgte der Personentransport zum 1.
März 1923. Vermutlich waren Probleme bei
der Anlieferung des Wagens der Hauptgrund -
schließlich war gerade Weltwirtschaftskrise
mit den bekannten Auswirkungen auf Leben
und Wirtschaft. Im ersten Fahrplan sind auch
die Preise genannt: eine einfache Fahrt mit
der Bahn von Obstfelderschmiede nach Cursdorf
kostete 350 Mark für fast 3,9 Kilometer
und einer Fahrzeit von dunnemals 32 Minuten.
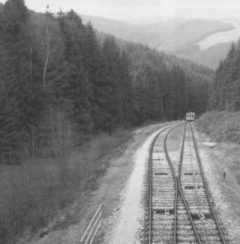 |
| Foto: Frank Böhnke |
 |
| Zugbegegnung an der Ausweiche der Steilstrecke. Kleines Foto: In der Talstation Ostfelderschmiede befindet sich die Drehscheibe, die den Gleisanschluß an das Normalspurnetz herstellt. Foto: Frank Böhnke |
|
In der Bergstation Lichtenhain an der Bergbahn
heißt es für die Fahrgäste umsteigen in
den elektrischen Triebwagen der Flachstrecke,
die Mitte Mai 1923 eröffnet wurde. Hier
endet der Steilstreckenteil mit immerhin bis
zu 25 Prozent Steigung. Wie auch in der Talstation
stellt hier eine Drehscheibe die mögliche
Verbindung zum Normalspurnetz her. Die
Triebwagen der Flachstrecke der Bergbahn
erinnern sehr an die auf der auf halber Strecke
zwischen Berlin und Frankfurt/Oder liegenden
Zweigbahn Müncheberg - Buckow eingesetzten
Fahrzeuge. Hier stellen sie die etwa
2,5 Kilometer lange Verbindung zwischen dem
Bergbahn-Endpunkt Lichtenhain und dem eigentlichen
Endpunkt der Bahn, dem Örtchen
Cursdorf, her. Auf der Zwischenstation der
Flachstrecke Oberweißbach-Deesbach wurden
vor einigen Jahren die Anlagen für den Güterverkehr
entfernt; die Kopframpe zum Be- und
Entladen der Güterwagen ist noch mit viel
Phantasie zu erahnen.
Die gesamte Bergbahn war, wie schon erwähnt,
eigentlich nur für den Güterverkehr
geplant. Das ist auch unschwer am Fahrplan
abzulesen: im Eröffnungsjahr 1923 gab es den
ganzen Tag über vier Fahrten im Personenverkehr,
auf der in Lichtenhain anschließenden
Flachstrecke nach Cursdorf eine und zurück
zwei Fahrten. Wer zwischendurch ins Tal oder
auf den Berg wollte, der mußte warten oder
laufen. Der Güterverkehr wurde 1966 eingestellt,
1976 und 1996 verschwinden die Nebengleise
im Bahnhof Oberweißbach-Deesbach.
Der um 1967 versuchsweise auf der
Flachstrecke eingesetzte Schienenbus der
Deutschen Reichsbahn soll wohl Erfahrungen
bezüglich der „Verdieselung" bringen, es
blieb aber bis heute beim elektrischen Inselbetrieb.
Die Schwarzatalbahn verzeichnet 1972/73
ihren verkehrlichen Höhepunkt. Bis zu fünf
Personen- und zwölf Güterzüge fahren täglich.
Nach der „Wende" ist ein dramatischer
Rückgang in beiden Bereichen zu verzeichnen.
Die Industrie bricht weg oder befördert nun
per Lkw, Besucher interessieren sich nicht
mehr im notwendigen Maße für einen Urlaub
im Thüringer Wald.
Was wird nun aus beiden Bahnstrecken -
aus der Schwarzatal- und der Bergbahn? Der
Sanierungsbedarf ist immens, das Risiko der
Fehlinvestition wird offenbar von den Verantwortlichen
bei der Deutschen Reichsbahn,
später der Deutschen Bahn AG, als sehr hoch
eingeschätzt. Andererseits besteht auch die
Verpflichtung zur Aufrechterhaltung des Verkehrs.
Das Ende: die Schwarzatalbahn ist von
Mai 2000 bis Dezember 2002 gesperrt. Glück
im Unglück hat die Bergbahn: da immer mehr
Touristen mit dem eigenen Pkw bzw. dem
Reisebus kommen, bedeutet der Wegfall der
Bahnfahrgäste aus Richtung Rottenbach einen
Ausfall, der aufzufangen ist. Anfangs bestand
seitens der Deutschen Bahn überhaupt keine
Neigung zur Investition. Es wurde hart mit
dem Freistaat Thüringen verhandelt, beide
Seiten ließen in der Öffentlichkeit „die Muskeln"
spielen. Schließlich, am 25. Juni 2001,
einigten sich beide Seiten mit der Unterzeichnung
eines neuen Verkehrsvertrages. Vielleicht
haben da auch die Ergebnisse zur Vermarktung
der Eisenbahn und Region im Zusammenspiel
endlich ihre Früchte getragen?
Die DE Consult hatte sich in einer Studie bereits
1998 mit diesem Thema befaßt. Minister
Schuster für den Freistaat und der DB AG-Vorsitzende
Mehdorn vereinbaren, die knapp
25 Kilometer lange Strecke von Rottenbach
nach Katzhütte (die Schwarzatalbahn) und die
Oberweißbacher Bergbahn (Steil- und anschließende
Flachstrecke) grundlegend zu sanieren.
Thüringen trägt von den 7,4 Millionen
Euro Gesamtinvestitionen 6,6 Millionen Euro.
Ab 1. Oktober 2001 ist dann auch für etwa ein
Jahr der Steilstrecken-Abschnitt der Bergbahn
gesperrt und wird saniert. Beide Bahnabschnitte
werden aus dem „Großkonzern" ausgegliedert
und das erste Projekt der DB AG-Mittelstandsoffensive
in Thüringen - deshalb
auch der „Bandwurmname".
Hätten die heutigen Mitarbeiter der OBS
vor gut zwei Jahren nicht den „Sprung ins
kalte Wasser" gewagt, wäre Thüringen um
eine Erfolgsgeschichte ärmer und die ganze
Region wäre für Ausflügler und Touristen, die
nicht mit dem Auto anreisen, uninteressant.
So konnte nicht nur eine weltweit einmalige
Touristenattraktion weiterbestehen, die Anbindung
einer ganzen Urlaubs- und Ferienregion
gesichert werden und die Natur des Thüringer
Waldes dankt es natürlich auch. Denn
der Tourismus ist mithin die einzige Einnahmequelle
der Bevölkerung.
Heute fahren auf der Schwarzatal bahn moderne
Fahrzeuge der Firma Aistom (Baureihe
641), die behindertengerecht sind. Apropos
behindertengerecht: auch Rollstuhlfahrer
brauchen sich weder die Fahrt auf der
Schwarzatalbahn als auch die 18 minütige
Bergbahn-Fahrt nicht entgehen lassen. Die
Fahrzeuge lassen die Mitnahme zu und das
freundliche und zuvorkommende Personal
beider Bahnen ist beim Ein- und Ausstieg gerne
behilflich.
 |
| Triebwagen auf der „Flachstrecke”. Foto: Frank Böhnke |
|
Die Fahrt von Rottenbach zur Bergbahn
nach Obstfelderschmiede oder weiter nach
Katzhütte ist, vorausgesetzt das Wetter spielt
mit, bereits eine Einstimmung auf den traumhaften
Ausblick vom Berg ins Tal und in den
Thüringer Wald. Zwar werden auf der 25 Kilometer
langen Schwarzatalbahn keine Geschwindigkeitsrekorde
gebrochen - die Durchschnittsgeschwindigkeit
beträgt 50 km/h -
aber dafür werden Besucher mit reizvollen
Landschaften belohnt. Und selbst Ingenieure
kommen auf ihre Kosten: 21 Brücken und
Durchlässe gibt es auf dem 10,5 Kilometer
langen Teilstück zwischen Obstfelderschmiede
und dem Endbahnhof Katzhütte.
Mit Ausnahme der Tal- und Bergstation der
Bergbahn machen viele der Unterwegshalte
einen unschönen Eindruck. An ihnen hat der
„Zahn der Zeit" genagt. Aber auch hier verspricht
Möller Hilfe. Mellenbach-Deesbach
soll 2004 auf Vordermann gebracht werden, in
allernächster Zeit soll dann Cursdorf folgen.
Die anderen Stationen sollen, so es der OBS
möglich ist, ebenfalls in ansehnlicheren Zustand
versetzt werden. Die Fahrzeuge wurden
ja schon im Rahmen der Streckensanierung
erneuert.
Wie dieser Zeitung der Geschäftsführer der
OBS, Peter Möller, bestätigte, haben sogar
Thüringer „ihre" Bergbahn wiederentdeckt
und nutzen sie zunehmend für Ausflüge. Mit
dazu bei trägt sicherlich das Bergbahnticket,
das sogar bis aus dem Erfurter Stadtgebiet
eine preiswerte Anreise erlaubt. Für
14,50 Euro können ein Erwachsener und Kinder/Enkel
nach Katzhütte und/oder Cursdorf
fahren. Garantiert wird dabei der Anschluß in
Rottenbach an die Schwarzatalbahn. Umfangreiches
Informationsmaterial mit vielen Wander-
und Besuchsvorschlägen (für die zahlreichen
Museen) liegt sowohl in den Zügen als
auch in der Fahrkartenagentur Obstfelderschmiede
aus.
Das erste „volle" Geschäftsjahr ist zu
Ende und Geschäftsführer Möller ist zufrieden.
Für die nächste Saison plant die OBS wieder
zahlreiche Veranstaltungen in deren Mittelpunkt
natürlich die Bergbahn steht. So sollen
die Fahrgastzahlen natürlich weiter steigen
und das Bestehen der OBS, der Arbeitsplätze
und die wirtschaftliche Bedeutung in
dieser Ferien- und Ausflugsregion gesichert
werden. DBV Bundesverband
|

