Diese
wird vor, während oder auch mal nach der
Fahrt von Mitarbeitern der Verkehrsunternehmen
kontrolliert.
Für das Unternehmen
reicht das Wort des Kunden, er habe für die
Fahrt bezahlt, also nicht aus.
 |
| Der Fahrgast im Fokus. Auf ihn sind Kameras gerichtet. Seine Daten werden gesammelt. Aber wozu? Und welche Probleme und Gefahren sind damit verbunden? Unser Themenschwerpunkt Sicherheit und Datenschutz. Foto: Raul Stoll, Bearbeitung: Holger Mertens |
|
Nun hat sich die Welt weiterentwickelt,
technisiert, digitalisiert. Das macht auch
vor den Fahrausweisen nicht halt. Statt Papierschnipsel
durch die Gegend zu tragen,
soll die Fahrberechtigung nun also elektronisch
gespeichert werden. Das ist ersteinmal
auch nicht schlimm. Trotzdem stellt
sich die Frage: Was wird da außer der reinen
Fahrberechtigung noch gespeichert?
Persönliche Daten?
Bereits eine ID, eine eindeutige Identifikationsnummer,
reicht aus, um die Frage
nach dem Datenschutz aufzuwerfen. Immer
wenn eine Überprüfung durchgeführt wird,
wird die ID fleißig ausgetauscht. Gemeinsam
mit den Informationen, wann,
wo und
wie häufig diese ID ausgelesen wurde, könnte
sie eine bei allen Unternehmen äußerst
begehrte Informationsquelle bilden. Denn
bereits nach wenigen Kontrollpunkten ließe
sich damit schon ein ziemlich gutes Fahrprofil
über den Eigentümer erstellen.
Hinzu kommt, dass diese ID keinesfalls
anonym
ist. Sie ist vielmehr eine Kartennummer.
Abgelegt im System und eindeutig Ihrem
Abo und Ihrer Person zugeordnet.
Nur ein Horrormärchen?
 |
| Sie benutzen die neue elektronische „fahrCard”? Gut! Jedoch nicht für Sie, aber für die Verkehrsunternehmen. Denn anonym ist sie wirklich nur für den Nutzer. Foto: IGEB |
|
In der VBB-Werbebroschüre ist zum Thema
Sicherheit Folgendes zu lesen:
„[…] Kann mein Verkehrsunternehmen
oder der VBB nun alle meine Fahrten nachverfolgen?
Nein, es ist weder technisch noch organisatorisch
möglich, sogenannte Bewegungsprofile
auf der Karte oder im System zu speichern. […]”
Diese Aussage ist schlichtweg falsch! Die
Karten basieren auf der sogenannten VDV-Kernapplikation
E-Ticket. In deren Spezifikationen
sind ausdrücklich Datenfelder für
allerlei persönliche Daten sowie einer gesamten
Fahrtenhistorie vorgesehen – für die
Karte, für die Schnittstellen zum Auslesen
und Schreiben sowie selbstverständlich vor
allem für das Hintergrundsystem.
„[…] Bei der Kontrolle wird Ihre persönliche
Chipkartennummer nur gegen eine Sperrliste
geprüft, um festzustellen, ob Ihre Fahrtberechtigung
noch gültig ist. Es werden keine personenbezogenen
Daten gespeichert. […]”
Unwahrscheinlich. Denn hier geht es ums
Geld. Die Karte kann vom Verkehrsunternehmen
so hoch verschlüsselt werden, wie es
will. Das schützt aber vor Clonen nicht. Clone
sind 1:1-Kopien der verschlüsselten Karten,
die beim Auslesen durch Kontrollgeräte nicht
vom Original unterschieden werden können.
Um Clone zu erstellen, muss man keine
Verschlüsselung knacken. Unbeschriebene
Karten-Rohlinge beispielsweise aus Fernost
übernehmen den gesamten verschlüsselten
Inhalt samt Karten-Produktions-ID von einer
beliebigen Original-Karte. In Anbetracht des
hohen Fahrkartenwertes einer Jahreskarte
ist der Anreiz für solche kriminellen Handlungen
durchaus gegeben.
 |
| Mit diesen stationären Geräten in Kundenbüros soll der Fahrgast kontrollieren können, was auf seiner Fahrcard gespeichert ist. Die Felder „Besitzer“ und „Geboren“ waren in einer früheren Version nicht zu sehen. Eine ID ist mit Sicherheit vorhanden, wird aber nicht angezeigt. Was ist außer diesen Feldern noch gespeichert? Foto: IGEB |
|
Doch wie kann ein Verkehrsunternehmen
dem vorbeugen? Da die Karten äußerlich
keinerlei Sicherheitsmerkmale tragen, ist die
optische Prüfung bei Kontrollen ungeeignet.
Da hilft nur, Karten-IDs bei jedem Lesevorgang
mit Ort und Zeit zu speichern, daraus
ein Bewegungsprofil zu erstellen und bei
ungewöhnlich häufiger Nutzung oder unmöglichem
Fahrverhalten auf mehrere Karten mit
derselben ID zu schließen und diese dann zu
sperren. Betroffen sind dann sowohl die Kopien
als auch das Original, dessen Eigentümer
nicht einmal wissen muss, dass seine Karte für
illegale Kopien verwendet wurde. Das Auslesen
der Karten erfolgt schließlich per Funk.
Das allein könnte aber erklären, warum
ungültige Karten bei der Kontrolle sofort
eingezogen werden. Und warum abgelaufene
Karten vom Kunden wieder zurück geschickt
werden müssen, obwohl Aufwand
und Porto die Kosten der Karte weit übersteigen.
Es erklärt auch, warum der Verlust
der Karte beim Kunden mit jeweils unverschämten
20 Euro (10 beim ersten Mal) zu
Buche schlägt.
„[…] Die Daten auf dem Chip sind grundsätzlich
nur von Mitarbeitern der Verkehrsunternehmen
mit speziellen Lesegeräten lesbar.
[…] Kunden können in Verkaufsstellen die auf
dem Chip gespeicherten Daten an speziellen
Kundeninformationsterminals (Infoterminals)
auslesen. […]”
Und das ist ein riesiges Problem. Durch die
Verschlüsselung ist es dem Fahrgast nicht
möglich, ungefiltert auf die Datensätze auf
der Karte zu schauen. Was man davon sehen
kann und was nicht, obliegt immer der vollen
Kontrolle der Unternehmen.
Vertrauensfrage
Doch kann man den Verkehrsunternehmen
trauen? Zumindest Skepsis ist angebracht.
In der Diskussion um Beibehaltung oder Abschaffung
des ständigen Buskneelings argumentierte
die BVG teilweise mit nicht nachvollziehbaren
Angaben wie der Behauptung,
es gäbe keine einzige Beschwerde dazu, obwohl
die IGEB von mehreren Beschwerden
wusste. Als unredlich empfanden viele Fahrgäste
auch eine BVG-Fahrgastbefragung,
deren Ergebnisse die BVG als Votum der Berliner
gegen Polstersitze und für Hartschalensitze
in der U-Bahn wertete, obwohl bei der
Umfrage ausschließlich Hartschalensitze zur
Auswahl standen.
Kann man den Unternehmen also glauben,
wenn sie behaupten, es werden mithilfe
der Fahrcard keinerlei personenbezogene
Daten erhoben, obwohl das möglich ist?
Werden sie sich auch einer Erhebung durch
Polizei oder Verfassungsschutz widersetzen
(dürfen)? Wer kontrolliert die Verkehrsunternehmen?
Die Fahrgäste können es nicht
überprüfen. Und das macht uns Sorge.
Die FahrCard-Probleme im Überblick
Verschlüsselung der Karte
Alle Unternehmen können die Daten auf der
Karte unkontrolliert lesen und schreiben.
Kriminelle müssen für ihre Machenschaften
die Verschlüsselung nicht knacken. Der einzige,
der durch die Verschlüsselung ausgesperrt
wird, ist der Kunde. Bleibt die Frage:
Wozu? Üblich wäre eigentlich, die Daten
klar zu speichern und zusätzlich eine verschlüsselte
Kontrollnummer, die die Richtigkeit der Daten belegt.
Speicherung von IDs bei Kontrollen
Falls die (eindeutig einer Person zuordenbaren)
Kartennummern systembedingt als Bewegungsprofil
vorliegen müssen, um Kartenkopien bekämpfen zu
können, wer hindert
die Unternehmen dann am letzten Schritt, diese
Information personenbezogen zu verwenden?
Die Daten sind da, die Versuchung ist groß
und eine Kontrolle nicht vorhanden.
Intransparenter Datenaustausch
Bei jedem Datenaustausch zwischen Karte und
Lesegerät können beliebig Daten gelesen,
geschrieben und gelöscht werden, ohne dass
einer der Beteiligten etwas davon
mitbekommen muss. So ließe sich über Nacht
eine neue Eigenschaft wie beispielsweise
„guter/schlechter Kunde” einführen.
Intransparente Infrastruktur
Selbst wenn auf der Karte außer der ID
nichts weiter gespeichert werden würde, so ließen
sich weitere Daten auf den Kontrollgeräten
mitführen. Beispielsweise könnte man
dem Kontrolleur beliebige Details
über den Kunden anzeigen, die zur gelesenen
Karten-ID passen. „Raucher”, „Querulant”, „nimmt
gern Schwarzfahrer mit” … Diese Reihe ließe
sich beliebig fortsetzen.
Der VBB informiert seine Kunden in einer Broschüre
folgendermaßen
„[…]
Welche Daten werden auf der VBB-fahrCard gespeichert?
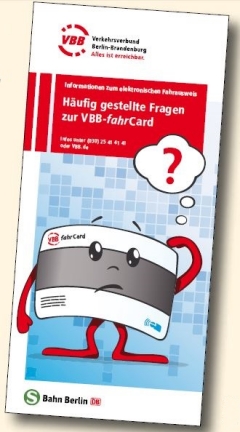 |
| VBB |
|
Auf der VBB-fahrCard werden nur Daten gespeichert, die bisher auch
auf dem Papierticket oder der
Kundenkarte enthalten sind. Bei unpersönlichen
Abonnements werden das Tarifprodukt, der tarifliche Geltungsbereich,
die Gültigkeit und die Kartennummer gespeichert. Bei
persönlichen Abonnements kommen Ihr Name sowie der Aufdruck
eines Lichtbildes hinzu. Kundenkarten sind somit nicht mehr notwendig
und entfallen. Über die gespeicherten Daten werden Sie beim Versand
der VBB-fahrCard von Ihrem Verkehrsunternehmen informiert.
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich die Daten auf Ihrer
VBB-fahrCard in ausgewählten Kundenbüros durch Kundenbetreuer
anzeigen zu lassen oder diese an Kundeninformationsterminals,
kurz Infoterminals, selbst auszulesen. Bei Namen werden dabei ggf.
nur die ersten zwölf Zeichen angezeigt. Eine Zusammenstellung aller
Kundenbüros, in denen Sie rund ums Thema VBB-fahrCard beraten
werden, sowie eine Übersicht aller verfügbaren Infoterminals finden
Sie unter VBB.de.
Kann mein Verkehrsunternehmen oder der VBB nun alle meine
Fahrten nachverfolgen?
Nein, es ist weder technisch noch organisatorisch möglich, sogenannte
Bewegungsprofile auf der Karte oder im System zu speichern.
Bei der Kontrolle wird Ihre persönliche Chipkartennummer nur gegen
eine Sperrliste geprüft, um festzustellen, ob Ihre Fahrtberechtigung
noch gültig ist. Es werden keine personenbezogenen Daten
gespeichert. Die (((eTicket-Systeme erfüllen die Anforderungen des
Datenschutzes der Länder sowie des Bundes und sind mit dem Berliner
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit sowie
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und für das Recht auf
Akteneinsicht Brandenburg abgestimmt.
Können Dritte beim Auslesen der Daten auf dem Chip (z. B. im
Verlustfall) Zugriff auf persönliche und/oder Kontodaten erlangen?
Die Daten auf dem Chip sind grundsätzlich
nur von Mitarbeitern der Verkehrsunternehmen
mit speziellen Lesegeräten
lesbar.
Bei persönlichen Zeitkarten wird der
Name des Karteninhabers auf der VBB-fahrCard
aufgedruckt und elektronisch
auf dem Chip hinterlegt.
Ein Zugang durch Dritte zu weiterführenden
persönlichen Daten und zu
Kontodaten durch Auslesen der Daten
auf dem Chip ist nicht möglich, da diese
nicht auf der Karte hinterlegt sind.
Kunden können in Verkaufsstellen die
auf dem Chip gespeicherten Daten an
speziellen Kundeninformationsterminals
(Infoterminals) auslesen. […]” Berliner Fahrgastverband IGEB
|

