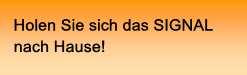|
|||||||||||||||||||||||||||||||

Man wollte die große, vermeintlich weltstädtische Lösung. Und so traf man im Jahr der S-Bahn-Übernahme die Entscheidung zum Weiterbau der U 8 ab Paracelsus-Bad. Daß man mit dieser unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten katastrophalen Fehlentscheidung auch noch die Geldgeber in Bonn nachhaltig verärgerte, nahmen die Berliner Politiker billigend in Kauf. Der Bau bis zum S-Bf Wittenau (jetzt Wilhelmsruher Damm) dauerte immerhin 10 Jahre und kostete bei einer Gesamtlänge von 4,2 km stolze 600 Mio DM. Dabei wurde auch noch der (Um-)Weg durch relativ dünnbesiedelte Ortsteile Reinickendorfs gewählt, u.a. unter dem Park der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik. Aber immerhin haben die Reinickendorfer Rathausfürsten nun einen eigenen U-Bahnhof vor der Haustür. Diese Strecke ist der am schlechtesten ausgelastete U-Bahn-Neubauabschnitt in Berlin. Die U-Bahn endet nun dort, wo die S-Bahn schon 70 Jahre vorher war - am S-Bf. Wittenau. Dort heißt es dann für viele Fahrgäste umsteigen in eine der zahlreichen Buslinien. Wie nun weiter?Bei der Inbetriebnahme im Jahr 1994 wünschten sich natürlich die Reinickendorfer Politiker den Weiterbau der U8. Aber ein Weiterbau in das Märkische Viertel ist aus finanziellen Gründen für die nächsten Jahrzehnte ins Reich der Utopie zu verweisen und würde eben nicht nur Vorteile für die ÖPNV-Benutzer bringen (vgl dazu SIGNAL 8/88). Im ansonsten bezüglich U-Bahn-Freihaltetrassen nicht gerade zurückhaltenden Flächennutzungsplan ist auf die Weiterführung bis zum Senftenberger Ring verzichtet worden. Und bei einer Verlängerung bis zum Märkischen Zentrum würde nicht mal ein Drittel der MV-Bewohner von einer direkten U-Bahn-Anbindung profitieren. Alle anderen hätten vermutlich Nachteile durch ein stark reduziertes Busangebot zu erwarten. Der Senat setzt beim U-Bahnbau ganz andere Prioritäten, so u. a. auf den Weiterbau der U 5 über den Lehrter Bf. hinaus in Richtung Moabit und Jungfernheide. Auch bei der Sanierung der U-Bahn stehen die großen Probleme noch an. Die BVG schiebt einen Sanierungsbedarf von ca. 4 Milliarden DM vor sich her, vom Senat erhält sie pro Jahr gerade mal 150 Millionen dafür. Und so bleibt für eine Schienenanbindung des Märkischen Viertel doch eine ganz andere Alternative. Unmittelbar hinter der ehemaligen Grenze befindet sich die Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 53 in Rosenthal. Der Straßenquerschnitt des Wilhelmsruher Damms läßt die Aufnahme einer Straßenbahntrasse mindestens bis zum Bf Wittenau zu. Ob und in wie weit die Straßenbahn direkt ins Märkische Viertel rund um den Senftenberger Ring fahren könnte, muß natürlich geprüft werden. In jedem Fall würde eine Straßenbahn für Fahrgäste nicht nur attraktiver sein, vor allem würde sich auch einen sehr viel wirtschaftlicheren Betrieb erlauben als die zahlreichen, vorzugsweise im Konvoi verkehrenden Busse. Für U-Bahn-Freunde bleibt ein Trost: Eine Straßenbahnstrecke ist nach ca. 25 Jahren abgeschrieben. Dann kann man erneut die Erforderlichkeit einer U8-Verlängerung prüfen. Das Märkischen Viertel hätte bis dahin aber endlich eine Schienenanbindung nach West und auch nach "Ost". Und vielleicht wird das Märkische Viertel auch ein Vorreiter für andere Großsiedlungen vor allem im ehemaligen Westteil Berlins, so z. B. für das Falkenhagener Feld in Spandau. Die mißlungene U-Bahn-Anbindung des Märkischen Viertels bleibt so eine ständige Warnung an diejenigen in der Stadt, die noch immer neue und teure Tunnelorgien planen. Eine Neuorientierung weg vom U-Bahnbau und hin zur Straßenbahn muß angesichts knapper Kassen das Gebot der Stunde sein. Man kann über die drei Ost-Berliner Plattenbezirke Marzahn, Hohenschönhausen und Hellersdorf viel Negatives sagen. Die ÖPNV-Infrastruktur aber ist in der Kombination von oberirdischem, in Bau und Unterhalt billigerem S- und U-Bahnbau, und mit einem großzügigen Straßenbahnnetz akzeptabel gelöst. Was macht man bloß mit der S-Bahn?Nachwehen eines Boykotts Schon der erste Abschnitt handelte über das Unvermögen der (West)-Berliner Verwaltungen, die S-Bahn sinnvoll in das Berliner Verkehrsnetz einzubinden. Doch auch an anderer Stelle ist es in diesem Bezirk gelungen, die S-Bahn ins Abseits zu schieben. Es gehört zu den unrühmlichen Kapiteln der Verkehrspolitik in dieser Stadt, daß ausgerechnet für den Autobahn-Bau eine S-Bahntrasse zerstört wurde und erst nach 15 Jahren zum Jahresende 1998 wieder in Betrieb genommen werden kann. So geschehen an der heutigen S 25 in Tegel. Aber auch der bisher wieder betriebene Abschnitt der S 25 zwischen Schönholz und Tegel ist alles andere als eine Erfolgsstory. Erinnert sei an das fast 5 Jahre währende Gezerre um die Betriebsform auf der S 25, ob nun die Regionalbahn oder die S-Bahn den Verkehr übernimmt. Herausgekommen ist der Kompromiß, die S-Bahn nur provisorisch wieder in Betrieb zu nehmen. Das hat zur Folge, daß die S-Bahn bis heute nur alle 20 Minuten fahren kann und der Umsteigebahnhof zur U 8 Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik für Fahrgäste eine Zumutung ist. Grotesk wird jedoch die Situation am derzeitigen Endpunkt der S 25 in Tegel. Bis heute fährt eine einzige Buslinie zum S-Bf Tegel, die mit Inbetriebnahme der S-Bahn bis Hennigsdorf eingestellt wird. Als einzige Veränderung sollen nun - vier Jahre nach der Wiederinbetriebnahme des S-Bahnhofes - bestehende Haltestellen (Tegelcenter und Gorkistraße/Ziekowstraße) von den Buslinien 120, 124, 125 und 222 näher an den zukünftigen Bahnübergang Gorkistraße verlegt werden. So haben Umsteiger zukünftig wenigstens etwas kürzere Wege zur S-Bahn. Wieso diese Anpassung allerdings vier Jahre dauerte, läßt sich in dem Zuständigkeitsdschungel zwischen BVG, Bezirksamt, Straßenverkehrsbehörde und Senatsverkehrsverwaltung kaum feststellen. Aber daß die BVG nicht gerade zu den engagierten Anhängern einer guten Umsteigesituation zur S-Bahn in Tegel zählt, ist ein offenes Geheimnis. Offen und ehrlich äußerte auch ein BVG-Vertreter schon mal, daß eine Busanbindung des S-Bf Tegel unnötig sei.
Selbst wenn es nun also zu der genannten Haltestellenverlegung kommen sollte, würde die Buslinie 133 auch weiterhin keine Verknüpfung mit der S-Bahn bieten. Dies ist um so ärgerlicher, da große Teile von Heiligensee ausschließlich durch diese Buslinie erschlossen werden und keine andere direkte Verbindung zur S-Bahn haben. Dabei wäre eine Wegführung über Grußdorf-, Budde- und Bernstorffstraße zumindest in dieser Fahrtrichtung sofort realisierbar. Um diese Wegführung auch in der Gegenrichtung zu realisieren, müßten allerdings die Einbahnstraßen-Regelung in der Grußdorfstraße aufgehoben werden, einige (wenige) Stellplätze entfallen und die Ampelanlage an der Berliner Straße umgebaut werden. Also ausreichend Gründe für Berliner Bedenkenträger um gegen eine solche Lösung zu votieren. Problemlos und kurzfristig realisierbar bliebe in dieser Fahrtrichtung die Wegführung über Budde- und Veitstraße. Der jetzige Zustand bedarf jedenfalls der Korrektur. Diese ist um so dringlicher, da das Fahrgastaufkommen auf der S 25 sich nach der Verlängerung bis Hennigsdorf drastisch erhöhen wird und die S-Bahn GmbH selbst mit vielen Umsteigern in Tegel rechnet. Ein Erbe und seine KostenKein Bus in der Citè Foch Nach dem Abzug der Alliierten übernahm die Bundesrepublik Deutschland in Berlin eine Vielzahl von interessanten und hochwertigen Liegenschaften. Dazu gehört die Citè Foch in Waidmannslust. Zum einen wird der Standort inzwischen als Wohnstandort genutzt. Und schließlich liegen ein Gymnasium und eine Schwimmhalle mitten in der Citè Foch. Umso unverständlicher ist die Tatsache, daß bis jetzt noch keine Buslinie die Cité Foch erschließt. Die BVG wäre dazu schon seit längerer Zeit bereit und hatte vorgeschlagen, auf dem Gelände der Cité Foch im Zusammenhang mit einer veränderten Linienführung eine zusätzliche Haltestelle der Buslinie 322 einzurichten. Die Fahrzeitverlängerung wäre minimal, zusätzliche Fahrzeuge und Personal wären nicht notwendig. Doch statt dessen geschieht seit Jahren nichts. Warum? Wie eingangs erwähnt, handelt es sich bei der Cité Foch um eine Liegenschaft des Bundes, das Land Berlin ist nur Nutzer. Für die Buslinie 322 wären einige geringfügige Anpassungen im Straßenraum erforderlich. Diese Anpassungen will nun der Bund nicht für einen fremden Nutzer machen. Umgekehrt will der Bezirk nun nicht für fremde Eigentümer Straßenbaulasten erbringen. Das wäre ja alles nun nicht weiter interessant, wenn nicht unter anderem Schüler des Gymnasiums die Leidtragenden dieses Unsinns wären. Wieder stellt sich nun die Frage: Wie weiter? Und trotz knapper Kassen bleibt vielleicht nur ein Weg. Der Bezirk sollte die Veränderungen im Straßenraum vorfinanzieren. Dabei ist es Reinickendorf natürlich freigestellt zu erklären, daß diese Vorfinanzierung keine Anerkennung der Straßenbaulasten in der Cité Foch darstellt, sondern ausschließlich im Interesse der Reinickendorfer erfolgt. Denn die Klärung der Straßenbaulast interessiert die Reinickendorfer sicherlich nicht so brennend. Wichtiger sind wohl akzeptable Busverbindungen im Bezirk! Wie gehts weiter in Berlin?Ein Fazit An diesen Reinickendorfer Beispielen wird deutlich, daß die verkehrspolitischen Entscheidungen im Großen wie im Kleinen in dieser Stadt ganz häufig zu Lasten der ÖPNV-Benutzer getroffen werden. Mangelnde (finanz-) politische Weitsicht, Gleichgültigkeit gegenüber den ÖPNV-Benutzern oder Verschanzen hinter ungeklärten Zuständigkeiten - daran krankt die Berliner Verkehrspolitik seit Jahrzehnten. Ob sich im nächsten Jahrtausend ein(e) Berliner Verkehrspolitiker/in findet, der/die über den ÖPNV nicht nur redet, sondern auch die Probleme löst? IGEB, Abteilung Stadtverkehr aus SIGNAL 8-09/1998 (November 1998), Seite 16-18
ANZEIGEN
|
ANZEIGE
|
||||||||||||||||||||||||||||||