Der Verkehr ist in Deutschland für rund 18
Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich.
Hauptverursacher mit einem
Anteil von 95 Prozent ist der Straßenverkehr.
 |
| Der Schienengüterverkehr ist durch den hohen Anteil der Elektrotraktion energieeffizient und klimaschonend. Die politischen Rahmenbedingungen konterkarieren bislang jedoch das Ziel „Mehr Verkehr auf die Schiene“. Foto: Christian Schultz |
|
Eine Verkehrsverlagerung von der Straße
auf die Schiene wäre daher zentraler
Bestandteil einer wirksamen Nachhaltigkeitsstrategie.
Der Schienenverkehr ist angesichts
der überlegenen physikalischen
Vorteile des Rad-Schiene-Systems und des
bereits heute hohen Anteils der Elektrotraktion
energieeffizient und klimaschonend.
Aber die Realität in Deutschland sieht anders
aus. Während es in den Jahren 2003 bis
2008 noch kontinuierliche Steigerungen des
Marktanteils der Schiene am gesamten Güterverkehr
von 15,7 Prozent auf 17,7 Prozent
gab, lag der Wert 2015 bei gerade einmal
18,0 Prozent. 2016 ist er sogar wieder auf 17,6
Prozent gesunken.
Staatlich induzierte Kostenbelastungen,
u. a. durch die Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), sorgten
ausgerechnet beim ressourcenschonenden
Schienenverkehr für spürbare Steigerungen
der Transportkosten. Und: Während die Trassenpreise
im Schienenverkehr kontinuierlich
angehoben wurden, profitiert der Straßengüterverkehr
von sinkenden Mautsätzen.
So lag der Durchschnittsmautsatz 2010 bei
17,42 Cent je Kilometer, 2016 dagegen nur
noch bei 14,2 Cent je Kilometer. Diese Rahmenbedingungen
konterkarieren damit jegliche
Verlagerungsziele.
Zehn Handlungsfelder zur Verbesserung
der Wettbewerbsfähigkeit des
Schienengüterverkehrs
Mit dem im Masterplan Schienengüterverkehr
beschriebenen Maßnahmenbündel soll
daher nun eine dauerhafte Verbesserung
der Wettbewerbs- und Logistikfähigkeit
des Schienengüterverkehrs erreicht werden.
Gelingen soll das mithilfe der nachfolgend
beschriebenen zehn Handlungsfelder.
1. Leistungsfähige Infrastruktur für den
Schienengüterverkehr bereitstellen
Das Schienennetz soll in den für den Güterverkehr
wichtigen Korridoren zügig ausgebaut
werden. Ein Schwerpunkt ist dabei
auch der Abbau von Engpässen in den
Großknoten. Im europäischen Schienengüterverkehr
hat sich der 740-Meter-Güterzug
als Standard etabliert. Die infrastrukturellen
Rahmenbedingungen für die durchgängige
Fahrbarkeit dieser Züge sollen daher – endlich
– geschaffen werden.
 |
| Im Masterplan Schienengüterverkehr ist auch ein Sonderprogramm zur weiteren Elektrifizierung des Schienennetzes enthalten. Bestandteil dieses Programms sollte auch die Ostbahn Berlin—Kostrzyn (Küstrin) als Entlastungs- bzw. Umleitungsstrecke für die Strecke Berlin—Frankfurt (Oder) sein. Foto: Sebastian Kliems |
|
Allerdings war das 740-Meter-Netz zunächst
nicht im „Vordringlichen Bedarf“
des Bundesverkehrswegeplans enthalten,
sondern lediglich im „Potenziellen Bedarf“.
Im September 2017 hat das Bundesverkehrsministerium
aber ein sehr positives
Bewertungsergebnis mit einem Nutzen-Kosten-Wert von 2 bekannt gegeben. Damit
sind nun die Voraussetzungen erfüllt, das
„740-Meter-Netz“ in den „Vordringlichen Bedarf“
aufzunehmen.
Auch die übrigen Maßnahmen des „Potenziellen
Bedarfs“ sollen möglichst kurzfristig
bewertet werden. Aber bis wann das erfolgen
soll, ist nicht vorgegeben.
Darüber hinaus sollen auch Lösungen für
die Machbarkeit von Zügen mit einer Länge
über 1000 Meter entwickelt werden.
2. Digitalisierung des Schienengüterverkehrs
vorantreiben
Ziel der Digitalisierung ist die Erhöhung der
Zuverlässigkeit und Transparenz sowie der
Sicherheit des Betriebs. Erhebliches Verbesserungspotenzial
besteht derzeit u. a. beim
digitalen Austausch von dem Transport vorauseilenden
Daten und von Echtzeitdaten
zwischen Eisenbahnverkehrsunternehmen
(EVU) und Kunden, aber auch bezüglich der
Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit bzw.
Minimierung von Störungen.
Deshalb soll die Fernüberwachung von
technischen Systemen (Sensorik zur Überwachung
von Weichen, Bahnübergängen
etc.) deutlich ausgebaut werden. Im Schienengüterverkehr
nimmt die Bedeutung
einer kurzfristigen, flexiblen Vergabe der
Schienenwegekapazität kontinuierlich weiter
zu. Durch den verstärkten Einsatz digitaler
Technik soll die nachfrageorientierte
Trassenvergabe künftig deutlich verbessert
bzw. beschleunigt werden.
Des Weiteren soll ein Sonderinvestitionsprogramm
zur Förderung der ETCS-Nachrüstinvestitionen
bei der Europäischen Union
eingefordert werden.
3. Eisenbahnbetrieb stärker
automatisieren
Zu den Maßnahmen, die in diesem Bereich
umgesetzt werden sollen, gehört u. a. die
Entwicklung der Technologie einer verteilten
Traktions- und Bremssteuerung (Distributed-Power-Technologie als Basistechnologie
für Züge mit 1500 m Länge). Das
Fahren langer Züge kann den Einsatz eines
zweiten Triebfahrzeugs erforderlich machen.
Um den Produktivitätsvorteil langer
Züge zu sichern, muss ein zweites Triebfahrzeug
von der führenden Lok ferngesteuert
werden können.
 |
| Unverständlich: Die Schieneninfrastruktur des Güterverkehrszentrums (GVZ) Berlin Ost Freienbrink wurde bislang nur selten genutzt. Auch hier bietet sich z. B. die Nutzung für den Kombinierten Verkehr an. Foto: Christian Schultz |
|
Bezüglich der Automatisierung wird auch
angestrebt, die heute übliche Schraubenkupplung
endlich durch eine automatische
Kupplung abzulösen. Dies würde die Zugbildung
deutlich effizienter machen bzw.
beschleunigen. Zudem würde das Personal
entlastet und das aus dem Entkuppeln/Kuppeln
resultierende Gefährdungspotenzial
erheblich reduziert. Entsprechende Planungen
gibt es hierzu zwar seit Jahrzehnten,
aber abgesehen von wenigen Ausnahmen
im Ganzzugverkehr ist eine Umsetzung auf
europäischer Ebene bislang leider nicht erfolgt.
4. Technische Innovationen für Schienenfahrzeuge
unter Berücksichtigung
von Wirtschaftlichkeit und Umweltperformance
der Schienenfahrzeuge
forcieren
Mit bereits erfolgreich entwickelten Hybrid-Triebfahrzeugen sind derzeit Einsätze im
Rangierbereich oder auch auf kurzen, nicht
elektrifizierten Streckenabschnitten möglich.
Bedarf besteht jedoch an entsprechenden
Fahrzeugen auch für den durchgehenden
Einsatz auf elektrifizierten und längeren
nicht elektrifizierten Strecken.
Bestandteil des Masterplans sind deshalb
u. a. die kurzfristige Schaffung von
Fördermöglichkeiten für die Entwicklung,
Beschaffung und den Einsatz von lärm-/emissionsarmen Lokomotiven und Hybridlokomotiven,
aber auch von innovativen
Güterwagen im Rahmen eines Bundesprogramms
„Zukunft Schienengüterverkehr“.
Neben der verbesserten Logistikfähigkeit
kommt hier der weiteren Reduzierung des
vom Schienengüterverkehr verursachten
Lärms besondere Bedeutung zu.
5. Multimodalität stärken sowie Zugang
zur Schiene sichern und ausbauen
Wichtige Elemente sind hier künftig die
verbindliche Berücksichtigung einer Schienenanbindung
im Planungs-/Umweltrecht
bei der Genehmigung und dem Bau von
aufkommensstarken Industrie- und Logistikstandorten,
die Fortsetzung bzw. offensive
Weiterentwicklung der Förderung von
Gleisanschlüssen sowie von Anlagen des
Kombinierten Verkehrs (KV).
Derzeit ist der Vor-/Nachlauf des KV durch
die Zulässigkeit höherer Gesamtgewichte
privilegiert. Die Ausdehnung dieses Privilegs
auch auf straßengebundene Vor- und
Nachläufe zum konventionellen Wagenladungsverkehr
ist daher als Maßnahme folgerichtig
in den Masterplan aufgenommen
worden.
6. Elektromobilität auf und mit der
Schiene ausbauen
Die weitere Elektrifizierung des Schienennetzes
ist ein wichtiges Element für den
durchgängigen elektromobilen Gütertransport.
Hierzu ist geplant, ein Sonderprogramm
zur weiteren Elektrifizierung des
Schienennetzes aufzulegen. Die Konzeption
und möglichst auch die Umsetzung sollen
dabei in der neuen Legislaturperiode erfolgen.
Besondere Bedeutung kommt hierbei
einer deutlichen Straffung der Planungs-,
Genehmigungs- und Realisierungszeiten
zu. Gerade im Hinblick auf die Erfüllung
der Ziele des Klimaschutzplans bzw. der bis
zum Jahr 2050 umzusetzenden Dekarbonisierung
des Verkehrs besteht hier akuter
Handlungsbedarf.
Für die Umstellung auf Elektrotraktion
sind die heute üblichen, sehr langen Realisierungszeiträume
völlig inakzeptabel, wie
aktuell das Beispiel der Strecke Ulm—Friedrichshafen—Lindau zeigt. Das Planfeststellungsverfahren
für den ersten Abschnitt
(Ulm / Alb-Donau-Kreis) wurde bereits im
August 2011 eingeleitet. Der Baubeginn im
Abschnitt Ulm—Laupheim West ist nunmehr
für das Frühjahr 2018 vorgesehen, die
Inbetriebnahme des gesamten Projekts im
Dezember 2021.
7. Trassen- und Anlagenpreise deutlich
reduzieren
Vor dem Hintergrund sinkender Mautsätze
und gesunkener Dieselpreise ist die Höhe
der Trassenpreise gerade für den preissensiblen
Schienengüterverkehr existenziell.
Die im Vergleich zur Straße gegenläufige
Entwicklung der Trassenpreise beeinträchtigt
inzwischen leider zunehmend die Wettbewerbsfähigkeit.
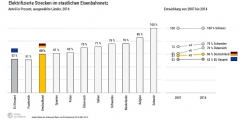 |
| Quelle: Allianz pro Schiene auf Basis von EU Kommission 2016, BMVI 2015. |
|
Geplant ist daher, temporär zusätzliche
Haushaltsmittel für eine deutliche Reduzierung
der Infrastrukturnutzungsentgelte zur
Verfügung zu stellen. Mit der vorgesehenen
Bereitstellung von 350 Millionen Euro an
Bundesmitteln kann ab 2018 die Wettbewerbsfähigkeit
des Schienengüterverkehrs
nun kurzfristig verbessert werden; daraus
resultierende finanzielle Freiräume ermöglichen
dringend erforderliche Investitionen
in die Modernisierung des Angebots. Diese
haushaltsfinanzierte Absenkung der Infrastrukturentgelte
soll künftig aber wieder
schrittweise zurückgeführt werden.
8. Abgaben- und Steuerbelastung
begrenzen
Ausgerechnet der Verkehrsträger Schiene,
der bei weitem den höchsten Anteil erneuerbarer
Energien aller Verkehrsträger einsetzt,
wird durch die Dreifachbelastung aus
Stromsteuer, Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) und Emissionshandel besonders benachteiligt.
Der Schienenverkehr wird damit gleich
mehrfach zur Finanzierung der Energiewende
herangezogen, konkurrierende Verkehrsträger
dagegen nicht. Um notwendige Korrekturen
zu erreichen, sind im Masterplan
folgende Teilmaßnahmen geplant:
- Die Kosten des Emissionshandels sollen
im Rahmen der anstehenden Reform ab
2018 kompensiert werden.
- Die Energiebesteuerung des Schienengüterverkehrs
soll vor allem beim Fahrstrom,
aber auch beim Traktionsdiesel den
Steuersätzen in den europäischen Nachbarländern
zumindest angeglichen und
abgesenkt werden (die Energiesteuerbelastung
für Fahrstrom beträgt in Deutschland
zurzeit überdurchschnittliche 11,40
Euro pro Megawattstunde).
- Die EEG-Umlage für den Schienenverkehr
soll möglichst auf das Niveau von vor 2014
zurückgeführt werden.
9. Vergleichbare Standards der Arbeitsund
Sozialvorschriften und Sicherheitsauflagen
bei allen Verkehrsträgern
gewährleisten
In Europa bestehen leider erhebliche Unterschiede
bei Löhnen und Sozialbedingungen.
Dies wird in Kombination mit der
Liberalisierung der Transportmärkte zumindest
teilweise in unerwünschter Weise
ausgenutzt. LKW-Kolonnen, zum Beispiel
in/aus Richtung Polen, technische
Mängel an Fahrzeugen, Lenkzeitüberschreitungen
und regelmäßig schwerste
Unfälle auf den Fernstraßen zeugen von
den negativen Auswirkungen dieser Entwicklung.
Auch das Umgehen des Mindestlohngesetzes
gehört dabei zum zweifelhaften,
aber festen Bestandteil des Geschäftsmodells
im Straßengüterverkehr. So wurden
zum Beispiel im September 2017 bei einer
entsprechenden Kontrolle durch den
Zoll in Frankfurt (Oder) bei jedem zehnten
Lastwagenfahrer Verstöße gegen
die Mindestlohnbezahlung festgestellt.
Dabei beträgt der Mindestlohn gerade
einmal 8,84 Euro je Stunde. Derartige
missbräuchliche Praktiken sind nicht akzeptabel!
Daher sind effektive Kontrollen bezüglich
der Tarif-, Arbeits- und Sozialvorschriften,
verbunden mit einer wirksamen Ahndung
bei festgestellten Verstößen, Grundlage
für faire Wettbewerbsbedingungen. Hierfür
sind auch auf EU-Ebene entsprechende
gesetzliche Regelungen erforderlich: Das
Tätigwerden von Briefkastenfirmen und
andere missbräuchliche Praktiken zum Unterlaufen
der Arbeits-, Sozial- und Sicherheitsvorschriften
muss auf EU-Ebene unterbunden
werden.
10. Aus- und Weiterbildung forcieren
Transportverlagerungen von der Straße auf
die Schiene sind nur möglich, wenn den
Bahnunternehmen ausreichend Fachkräfte
zur Verfügung stehen. Bereits derzeit besteht
erheblicher Nachholbedarf bzw. Personalmangel
u. a. bei Triebfahrzeugführern.
Ein weiteres großes Problem ist mittlerweile,
dass in den Ausbildungsordnungen
für Speditionskaufleute die fachliche Ausbildung
für den Verkehrsträger Schiene
nicht obligatorisch vorgesehen ist, sondern
lediglich optional. Dies bedeutet in der Praxis
letztlich eine Fokussierung auf den Straßengüterverkehr.
Folgerichtig wurde daher
im Masterplan das Ziel eingebracht, dass
Ausbildungsinhalte zum Verkehrsträger
Schiene verpflichtend in die Ausbildungsordnung
und in den Rahmenlehrplan für
Speditionskaufleute aufgenommen werden.
Diese Maßnahme soll kurzfristig umgesetzt
werden.
Fazit: Entscheidend ist die Umsetzung
der Maßnahmen
Mit dem Masterplan Schienengüterverkehr
wurde ein erster Schritt getan, um die Situation
des Schienengüterverkehrs zu verbessern.
Angesichts zum Teil jahrzehntelang
bekannter Probleme ist es jedoch unverständlich,
dass der Masterplan erst am Ende
der Legislaturperiode 2013 bis 2017 fertiggestellt
wurde. Damit wurde nochmals deutlich,
dass der bisherige Verkehrsminister
Alexander Dobrindt seine Amtszeit hauptsächlich
dafür genutzt hat, einseitig die Interessen
der Automobil-Lobby umzusetzen.
Sein dreistes Manöver bezüglich der umstrittenen
Zulassung von Lang-LKW zum
Jahreswechsel 2016/2017 sei an dieser Stelle
beispielhaft genannt. Der straßenlastige
Bundesverkehrswegeplan ist ein weiteres
unrühmliches Beispiel.
Es ist nun Aufgabe der neuen Bundesregierung,
die vielen Einzelmaßnahmen auch
aktiv und vor allen Dingen zügig umzusetzen
und zu konkretisieren. Ob die heute
unbefriedigende Situation für den Schienengüterverkehr
sich in naher Zukunft tatsächlich
wesentlich verbessert, muss sich
leider erst noch zeigen!
 |
| Mit dem Masterplan wurde nur ein erster Schritt zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Schienengüterverkehrs getan. Es ist Aufgabe der neuen Bundesregierung, die Einzelmaßnahmen nun zügig umzusetzen! Foto: Sebastian Kliems |
|
Der DBV erarbeitet derzeit Vorschläge,
wie der „Master“-Plan konkreter und praxistauglicher
gestaltet werden sollte. Insbesondere
muss dem Ziel einer tatsächlichen
nachhaltigen Verkehrsverlagerung
hin zur Schiene wesentlich stärker Rechnung
getragen werden – das vorliegende
Papier kann hier noch nicht überzeugen.
Auch spielen Verkehrsvermeidungsansätze
leider überhaupt keine Rolle!
Deutscher Bahnkunden-Verband (DBV) und
IGEB Fernverkehr
|

