|
Es ist ein Allgemeinplatz, dass Berlin wächst.
Das hat aber deutliche Auswirkungen auf
den Verkehr der Region. Es wohnen nicht
nur mehr Menschen hier, diese Menschen
müssen auch immer weitere Wege zurücklegen.
Vor diesem Hintergrund sind die
Vorzüge und Möglichkeiten des Systems
Gleichstrom-S-Bahn bisher zu wenig betrachtet
worden. Deshalb hat sich der Berliner
Fahrgastverband IGEB entschlossen,
einige grundsätzliche Vorstellungen zusammenzufassen
und eine Vision zur Zukunft
der Berliner S-Bahn zu entwickeln.
Die Anfänge
 |
| S-Bahn oder R-Bahn nach Falkensee? Ein Vierteljahrhundert wurde im Havelland erbittert gestritten, ob die S-Bahn von Spandau verlängert oder der Regionalverkehr ausgebaut werden soll. Der Berliner Fahrgastverband IGEB fordert auch hier S-Bahn UND Regionalbahn. Fotos und Montage: Raul Stoll |
|
Die Berliner S-Bahn konnte schon 1924 auf
über 80 Jahre Vorlaufverkehr aufbauen.
Auch das macht sie im Vergleich zu vielen
anderen Städten einmalig. Die Eisenbahn
wurde von Anfang in und um Berlin sehr
bewusst als Erschließungssystem der wachsenden
Metropole wie auch der gesamten
Region genutzt. Dabei wurde schon sehr
früh erkannt, dass Stadt- und Vorortverkehr
andere Anforderungen stellen als Fern- und
Regionalverkehr. Aus diesem Grund wurden
ab den 1870er Jahren sowohl Stadt- wie auch
Ringbahn durchgängig viergleisig gebaut.
Damit war eine konsequente Trennung von
Anfang an möglich. Dies gilt größtenteils
auch für die Vorortstrecken. Dem wurde
unter anderem mit einem eigenständigen
Tarif für den „Stadt-, Ring- und Vorortverkehr“
Rechnung getragen. In den heutigen
Berlin-ABC-Tarifzonen kann man noch heute
die konsequente Fortsetzung dieses erfolgreichen
Tarifmodells erkennen.
Mit der Elektrifizierung ab 1924 wurde
diese Trennung konsequent weitergeführt.
Dazu gehörten auch revolutionär
neuartige Fahrzeuge mit niveaugleichem
Einstieg und der noch heute bekannten
Innenaufteilung, deren Gestaltung
kürzeren Fahrstrecken und häufigerem
Fahrgastwechsel angepasst war.
Ab 1930 firmierte diese neue Form des
Eisenbahnverkehrs unter dem Namen
S-Bahn – als Abkürzung für Stadtschnellbahn
– und bekam ihr eigenes Logo. Zur
Stärkung der Marke S-Bahn trug die
einheitliche und auffällige Farbgebung
bei. Damit hatte Berlin – zusammen mit
der U-Bahn – ein hochleistungsfähiges
Schnellbahnnetz, das Millionen Menschen
zuverlässig beförderte.
 |
| S-Bahn-Tarifbereich 1949. Dieser Bereich war größer als das von S-Bahn-Zügen befahrene Netz. Wer schon keine „richtige“ S-Bahn hatte, konnte wenigstens zum günstigen S-Bahn-Tarif fahren, z. B. nach Fürstenwalde und Nauen. „S-Bahn-Anschluss“, und sei es nur der Tarif, war stets ein Qualitätssiegel für Kommunen im Berliner Umland. Sammlung S-Bahn-Museum |
|
Den Erfolg des Systems S-Bahn kann man
auch daran erkennen, dass es vielerorts kopiert
wurde. So ist die fahrgaststärkste Linie
des Schienenverkehrs auf der Welt überhaupt,
die Yamanote-Ringbahn von Tokio,
in den 1930er Jahren nach dem Vorbild der
Berliner Ringbahn entstanden.
Wie wichtig dieses Netz war, zeigte sich
besonders nach 1945, als es trotz widrigster
Umstände und mit viel Improvisation bereits
drei Jahre später wieder in voller Länge
befahrbar war und sogar erste neue Verlängerungen
erfolgten.
Die Zeit zwischen Mauerbau 1961 und
Mauerfall 1989 war bekanntermaßen durch
Stillstand im Westteil Berlins und Ausbau
im Ostteil Berlins (mit Umland) geprägt.
Danach wurden in wenigen Jahren die
meisten durch den Mauerbau verursachten
Lücken wieder geschlossen, aber viele
einstige S-Bahn-Strecken gibt es bis heute
noch nicht.
Hemmnisse nach 1989
Vor allem zwei Dinge bremsten die Entwicklung
seit der deutschen Wiedervereinigung.
 |
| Noch bis 1983, 22 Jahre nach dem Mauerbau, fuhren S-Bahn-Züge im Inselbetrieb von Hennigsdorf nach Velten. Immer mehr Veltener fordern die Rückkehr der S-Bahn in ihre Stadt. Foto: Dietrich Richter, Sammlung Michael Müller |
|
Zum einen hat das Land Brandenburg
die Vorteile eines eigenständigen und autarken
Eisenbahnsystems für das Berliner
Umland lange Zeit geleugnet. Wer S-Bahn-Verlängerungen
forderte, bekam fast so viel
Gegenwind, wie ein West-Berliner, der nach
dem Mauerbau 1961 noch mit der S-Bahn
fuhr. Auf Brandenburger Regierungs- und
Ministerialebene gab es einen „Boykott“ des
Systems S-Bahn, begründet mit zu hohen
Kosten und eingebettet in eine allgemein
autofixierte Verkehrspolitik.
Dabei waren in Bernau, Neuenhagen
oder Eichwalde die Vorteile der S-Bahn immer
präsent. In Immobilienanzeigen wurde
als Qualitätsmerkmal – S-Bahn-Anschluss –
hervorgehoben.
Zum anderen hat das politisch verursachte
„Kaputtsparen“ der S-Bahn durch den
Mutterkonzern Deutsche Bahn der Reputation
der S-Bahn schwer geschadet. Der seit
2009 miserable Ruf wird den tatsächlichen
Qualitäten des Systems S-Bahn in keiner
Weise gerecht und hat es den Gegnern leicht
gemacht. Aber für die Zeit ab 2024 besteht
Hoffnung auf eine deutliche Leistungssteigerung
und Stabilisierung – und von diesem
Zeithorizont reden wir realistischerweise bei
S-Bahn-Streckenverlängerungen.
Ein System voller Möglichkeiten
Die unschlagbaren Vorteile des Systems
S-Bahn liegen in seiner vollständigen und
umfassenden Unabhängigkeit gegenüber
der „großen“ Eisenbahn. Wenn es dort Störungen
gibt, so betreffen diese erst einmal
nicht die Berliner S-Bahn. Und umgekehrt.
Daher ist eine vollständige und dauerhafte
Trennung von S-Bahn und „großer“ Eisenbahn
erforderlich.
So wäre es zum Beispiel falsch, beim notwendigen
Einführen des RE 6 auf der Kremmener
Bahn von Hennigsdorf über Tegel
nach Gesundbrunnen die S-Bahn-Gleise
mitzunutzen. Die Verspätungen des Regionalverkehrs
dürfen nicht in das S-Bahn-Netz
übertragen werden.
Mit dem wünschenswerten weiteren
Wachstum des Fern- und Güterverkehrs auf
der Schiene wird das Wachstum des Regionalzugangebots
aus dem Berliner Umland
in die Berliner Innenstadt auf den Hauptstrecken
unweigerlich begrenzt. Die S-Bahn
mit ihrem eigenen Gleichstromnetz kann
nicht verdrängt werden. Deshalb kann und
muss sie mittel- bis langfristig den größten
Teil des regionalen Berlin-Umland-Verkehrs
bewältigen.
Wann ist der II. Weltkrieg bei der
Berliner S-Bahn endgültig vorbei?
Die Berliner Ringbahn ist genau genommen
in ihrer jetzigen Betriebsdurchführung ein
Provisorium. 1944 waren die Zerstörungen
von Fahrzeugen und Bauwerken in Berlin
auch bei der S-Bahn schon so umfangreich,
dass die Deutsche Reichsbahn ein umfassendes
Programm zur radikalen Vereinfachung
des Betriebes umsetzen musste. Bis
zu diesem Zeitpunkt gab es keinen Vollringverkehr,
wie wir ihn heute kennen.
Doch die Infrastruktur ist bis heute nicht
„Ring-tauglich“. Um Verspätungen nicht auf
nachfolgende Züge zu übertragen, muss –
wie auf der Stadtbahn – ein 90-Sekunden-Abstand
möglich sein. Des Weiteren fehlen
Möglichkeiten zum Ein- und Aussetzen
sowie zum Tauschen von Zügen. So muss
endlich die lange geplante dritte Bahnsteigkante
in Westend gebaut werden.
Ein weiteres Problem der Kriegsfolgen
betrifft fast alle Außenäste der S-Bahn. Auf
vielen dieser Vorortstrecken hatte es vor
dem Krieg noch einen mehrgleisigen Mischbetrieb
von S-Bahn und Fernverkehr gegeben.
Das war damals so lange möglich, wie
die Zugdichte es zuließ und der Fernverkehr
mit Dampflokomotiven fuhr. Allerdings war
auch dort die Entflechtung ein ständig fortschreitender
Prozess, der zum Beispiel zwischen
Wannsee und Potsdam abgeschlossen
war. Der Krieg unterbrach die weitere
Trennung, die zum Beispiel auf der heutigen
Dresdner Bahn noch nicht erfolgt war.
Unmittelbar nach Kriegsende gab es
umfangreiche Demontagen durch die sowjetische
Siegermacht als sofort verfügbare
Reparationen für den Wiederaufbau in der
UdSSR. Davon betroffen waren auch die
Vorortstrecken der Berliner S-Bahn. In vielen
Fällen wurde das abgebaute zweite Gleis bis
heute nicht wiederhergestellt. Das betrifft
die Außenäste von S 1 und S 2, insbesondere
auf Brandenburger Gebiet, und bei der S 25
auch mehrere Abschnitt im Berliner Stadtgebiet.
Der bekannteste Fall ist die Strecke
zwischen Wannsee und Potsdam. Die unattraktiv
lange Fahrzeit entsteht insbesondere
durch weitgehende Eingleisigkeit auf
diesem Abschnitt. Zugbegegnungen sind
nur in den Bahnhöfen möglich und Verspätungen
übertragen sich sofort auf den
Gegenzug. Dabei lassen sich dort durch
einen zweigleisigen Wiederaufbau rund
fünf Minuten Fahrzeitgewinn herausholen.
Aber das Brandenburger Engagement
beschränkte sich bis heute auf zusätzliche
Infrastruktur und zusätzliche Züge nur im
Regionalverkehr.
Bezahlen muss den Wiederaufbau der
zweiten Gleise aus IGEB-Sicht der Bund,
denn die Demontagen waren Kriegsfolgen,
und die Bundesrepublik hat als Rechtsnachfolger
des Deutschen Reiches für die Beseitigung
dieser Kriegsfolgen aufzukommen.
Zweigleisig ausgebaut werden müssen
auch die Abschnitte zwischen Hoppegarten
und Strausberg (Vorstadt) sowie zwischen
Eichwalde und Königs Wusterhausen.
Mit der Zweigleisigkeit wird nicht nur die
Übertragung von Verspätungen auf die Gegenrichtung
vermieden, sondern es werden
auch stabil fahrbare und zunehmend erforderliche
Taktverdichtungen möglich.
Parallelverkehr zum Nutzen der
Fahrgäste
Die künftig erforderliche Arbeitsteilung
zwischen überregionalem Regionalexpress-Verkehr und regionalem S-Bahn-Verkehr
erfordert natürlich auch parallele Angebote
auf allen wichtigen Hauptachsen.
So, wie heute Regionalexpress-Züge UND
S-Bahn-Züge nach Oranienburg und Erkner
fahren, so müssen künftig neben den
Regional(express)zügen S-Bahn-Züge auch
nach Velten, Rangsdorf und Falkensee fahren.
Eine weitere Verlängerung von Falkensee
nach Nauen muss berücksichtigt werden.
Das aus einem Spar-Wahn heraus entstandene
Dogma des „Entweder-Oder“ muss
aufhören. Oranienburgs Bürgermeister
Hans-Joachim Laesicke weiß die Vorteile des
„Sowohl-Als-Auch“ zu schätzen: „Die S-Bahn
und die Regionalbahnen aus beziehungsweise
nach Berlin sind wichtige Lebensadern für
unsere Stadt! Um einen Infarkt zu vermeiden,
ist es deshalb unabdingbar, dass die S 1 mindestens
in der Hauptverkehrszeit im Zehn-Minuten-Takt fahren muss. Aber auch RE 5,
RB 20 und künftig RB 32 müssen so attraktive
Angebote machen, dass die Benutzung eines
Pkw keine sinnvolle Alternative mehr darstellt.“
 |
| Auch Falkensee verlor seinen S-Bahn-Anschluss durch den Mauerbau. Erbitterte Auseinandersetzungen zwischen S-Bahn- und Regionalbahnbefürwortern haben dazu geführt, dass das Havelland auch 28 Jahre nach dem Mauerfall noch keine S-Bahn hat, sondern nur Regionalzüge, die oft unpünktliche und überlastetet sind. Sammlung Michael Müller |
|
Während beispielsweise in Velten seit Jahren
die S-Bahn gefordert wird, wird in Falkensee
und anderen Teilen des Havellandes
die Bedeutung einer Integration in das Berliner
Schnellbahnnetz mit seiner wesentlich
feineren Erschließung vielfach unterschätzt.
Dabei sollte klar sein: Nur diejenigen Umlandgemeinden
gehören auch wirklich zum
Ballungsraum Berlin, die mit der Berliner
S-Bahn erreichbar sind. Schon jetzt kann
ein Investor oder ein Wohnungssuchender
davon ausgehen, dass die S-Bahn rund 19
Stunden am Tag mindestens alle 20 Minuten
fährt, am Wochenende auch nachts.
Die Bedeutung der S-Bahn hat selbst das
Flugzeugmotorenwerk von Rolls-Royce in
Rangsdorf erkannt und drängt auf eine südliche
Verlängerung der jetzigen S 2, welche
dann eine verlässliche Minimalanbindung
nach Berlin garantiert. Auch die Gemeinden
Teltow, Stahnsdorf und Kleinmachnow
fordern Verlängerungen bzw. den weiteren
Ausbau der S-Bahn, da diese sowohl die
Verbindung mit Berlin herstellt als auch die
Grundlage eines soliden lokalen Nahverkehrs
schafft.
 |
| Potsdam-Golm ist ein wichtiger Wissenschaftsstandort in der Landeshauptstadt. Vielleicht werden die S-Bahn-Züge eines Tages von Potsdam Hbf hierher verlängert. Foto: Raul Stoll |
|
Innerhalb Potsdams ist die Entscheidung
für die Regionalbahn zwischen Golm und
Griebnitzsee zumindest eine Überprüfung
wert. Wenn man die S-Bahn von Potsdam
Hauptbahnhof hinaus nach Golm verlängert,
hat man eine sehr gute Möglichkeit,
eine innerörtliche Potsdamer S-Bahn zu
schaffen, die darüber hinaus ein direkter
Teil des Schnellbahnnetzes von Berlin ist.
Dabei ist klar, dass die Streckenführung
durch historisch wertvolle Areale führt, deren
bauliche Gestaltung besondere Sensibilität
erfordert.
All diese Überlegungen (mehr dazu im
nachfolgenden Artikel) müssen als Teil der
gemeinsamen Entwicklung des Berlin-Brandenburger
Ballungsraumes gesehen werden.
Dazu gehören anstehende Entscheidungen
bei der Infrastruktur. Dazu gehört, in der
Vertragsgestaltung sicherzustellen, dass die
Deutsche Bahn wieder ausreichend Personal
in der Fläche vorhält, um auf Störungen
schneller und besser reagieren zu können.
Dazu gehört, dass alle Fahrzeuge der S-Bahn
ab 2024 wieder 100 km/h technisch sicher
fahren können. Um den absehbar steigenden
Bedarf decken zu können, sollte man
bei der derzeit laufenden Beschaffung neuer
Fahrzeuge der Baureihe 483/484 die zusätzlich
zulässigen 10 Prozent mehr an Fahrzeugen
gleich mitbestellen.
Der prognostizierte Zuwachs bei Bevölkerung
und Arbeitsplätzen im Raum Berlin
sind nur mit dem leistungsfähigen und
umweltfreundlichen Schienenverkehr zu
bewältigen.
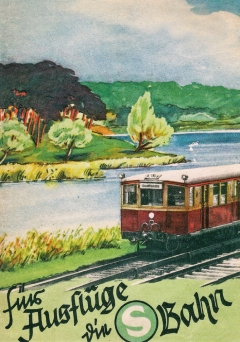 |
| Mit solchen Plakaten warb die Deutsche Reichsbahn um 1930 für Ausflugsfahrten mit der Berliner S-Bahn. Archiv S-Bahn-Museum |
|
Das in 150 Jahren aufgebaute Berliner
Stadt-, Ring- und Vorortbahnnetz bietet
hervorragende Voraussetzungen, darauf
das S-Bahn-Netz für das 21. Jahrhundert
zu entwickeln. Es bietet zugleich die Möglichkeit
einer sinnvollen und langfristig
notwendigen Aufgabenteilung zwischen
dem Fern- und weiten Regionalverkehr und
dem regionalen Berlin-Umland-Verkehr, der
überwiegend von der S-Bahn bewältigt
werden kann und muss.
Berlin und Brandenburg – beendet den
planerischen Boykott der S-Bahn! Macht sie
zusammen mit der U-Bahn zum zentralen
Verkehrsmittel des Ballungsraums. Die Regionalzüge
haben dann mehr Kapazitäten, um
Städte und Gemeinden jenseits des Tarifgebietes
Berlin C an die Metropole anzubinden.
(jw)
Berliner Fahrgastverband IGEB
|

