 |
Für die Planer der BVG schlug die Stunde
der Wahrheit eigentlich schon ein paar Monate
vor der Maueröffnung. Man schrieb
den Frühsommer 1989, als aus Ost-Berlin
Überlegungen herüberdrangen, zur Verbesserung
des ost-halbstädtischen Nahverkehrs
die im Bezirk Mitte gelegenen Bahnhöfe
der U-Bahn-Linie 6 selbst zu nutzen. Ein
Ersatz für das "Herzstück" der von täglich
rund 80.000 Fahrgästen genutzten Untergrundverbindung
mußte also schnell gefunden werden. “Damals hatten wir schon den
Ansatz 'Was wäre, wenn ...' und haben erstmals unsere
neue Software angeworfen",
berichtet Abteilungsleiter Hartmut Schmidt.
Weil niemand auf die wichtige Nord-Süd-Strecke verzichten
wollte, erarbeiteten die
Planer in Windeseile die Variante eines Paralleltunnels.
Wie bei anderen Problemlösungsvorschlgen hatten sie dabei zugleich
langfristige Verkehrsbedürfnisse im Blick.
Schmidt: “Wir hatten uns daran erinnert,
daß Großstädte wie New York und Paris für
ihre Rapid-U-Bahnen durchaus auch viergleisige Tunnel
haben. Angedacht war, bei
einer Wiedervereinigung, die damals noch
als Utopie galt, auf einer solchen leistungsfähigen
Trasse ebenfalls Schnellzüge fahren
zu lassen. Glücklicherweise", so Schmidt,
mußte es auf Grund der politischen Zeitläufe
zu dem auf etwa 600 Millionen DM veranschlagten
Tunnelneubau nicht mehr kommen. “Das hatte ja
bedeutet, daß innerhalb
der Stadthälften eine Trennung zementiert
worden wäre."
Von der Maueröffnung waren die Planer im
6. Stock der BVG-Hauptverwaltung an der
Potsdamer Straße in Schöneberg zunächst
genauso überrascht wie die Politiker und
Bürger. Angesichts der gewaltigen neuen
“Verkehrsströme" der Besucher aus Ost-Berlin
und der DDR entstand der spontane
Eindruck, daß nun alle bisher entwickelten
Konzepte plötzlich zur Makulatur geworden
waren. Freilich habe dieses Gefühl der Unsicherheit
nur in den ersten 14 Tagen überwogen,
sagt Hartmut Schmidt. Wesentliche
planerische Vorgaben des damaligen rot-grünen
Senats wie zum Beispiel der schnelle
Ausbau des Schienennetzes der Stadt, die
Neuordnung des Busnetzes mit zahlreichen
neuen Busspuren oder die Fragen einer
Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt
hätten sich auch unter den neuen Verhältnissen
als goldrichtig erwiesen. Diese Vorgaben zugunsten
eines öffentlichen Nahverkehrs umzusetzen,
sei nach dem 9. November 1989 nur noch "viel dringlicher“
geworden.
Verschoben werden muBte erst einmal das
angekündigte “Busnetz '90". In den Randbereichen
des ehemaligen West-Berlin zum
Umland und zum Ostteil der Stadt waren
bei dem Konzept natürlich Korrekturen fällig.
Notwendig wurde eine Verknüpfung der
Umsteigemöglichkeiten zum Schienenverkehr.
Im Zuge der Einführung neuer dreistelliger
Liniennummern müssen auch erst
alle Anzeigesysteme, Entwerter und Automaten
umgestellt werden. Jetzt, so Schmidt,
soll ein Teil der Maßnahmen zum Fahrplanwechsel
am 2. Juni realisiert werden, der
restliche Teil ein Jahr darauf. Erst 1992/93
werde es möglich sein, Buslinien im ehemaligen
Grenzbereich zu Ost-Berlin so richtig
zu verknüpfen. Das liege daran, daß Straßen,
Brücken und Kehrmöglichkeiten zum
Teil noch nicht früher zur Verfügung stünden.
Aber: “Ende 1993 gibt es dann ein
Busnetz, das von der Netzqualität her in
sich schlüssig ist."
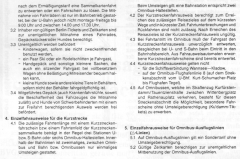 |
| Auszug aus den BVG-Tarifbestimmungen. Den komplizierten Kurzstrecken-Tarif soll es nach dem Willen der BVG-Planer nicht mehr lange geben. |
|
Auf der Basis von aktuellen Verkehrszählungen
flexibel an der Streckenführung von
Buslinien herumzutüfteln und dabei neue
Busspuren oder Haltestellenkaps zu konzipieren,
ist eine nicht unwichtige Aufgabe
der BVG-Planungsabteilung. Schließlich
gibt es die lautstärksten Kundenproteste,
wenn an der BVG-"Oberfläche" Chaos
herrscht. Schon durch die Lawine von Bauvorhaben
der letzten Jahre nimmt aber der
Schienenverkehr zum überwiegenden Teil
die Kapazitäten der Planer in Anspruch.
Auch wenn die Reichsbahn jetzt der größere
Partner ist, fühlt man sich vor allem nach
wie vor zuständig für die S-Bahn. Schmidt
zufolg: begleitet die Abteilung, primär aus
verkehrlicher Sicht sowohl die Vorbereitung
als auch die Durchführung jedes Strecken-
und Bahnhofsbauvorhabens im S- und U-Bahn-Bereich.
“Bis hin zu jedem einzelnen
Raum" werde die Gestaltung von Bahnhöfen mit
der Senatsbauverwaltung abgestimmt - beispielsweise
auf dem Südring
oder der S6. Zu den traditionellen Aufgaben
der BVG-Planer gehört es in dem Zusammenhang
auch, sich speziell um die sogenannten "kleinräumigen"
Verkehrsströme zu kümmern. Die immer wieder aufgeworfene
Frage der Planer: Wie kann der
Fahrgast von der Bushaltestelle auf möglichst
kurzem Weg möglichst wenig schweißtreibend
zu den Zügen gelangen? Über
Fahrtreppen und Aufzüge, lautet mittleweile
die Standardantwort. Als am kompliziertesten
beschreibt Schmidt die Optimierung von
Umsteigebeziehungen zur U-Bahn
auf dem ersten Buabschnitt des Südringes,
Um hier eine Verknüpfung mit der U-Bahn
zu erreichen, müßten die Bahnsteige der
Bahnhöfe Wilmersdorf und Schmargendorf
“verschoben" werden.
Worauf Abteilungsleiter Schmidt nicht wenig
stolz ist: Die Arbeiten zur beschlossenen
"Durchbindung" der U-Bahn-Linie 2 werden die
BVG-Planer sogar koordinierend
begleiten. Der Chefplaner: “Wir sind also
diejenigen, die die einzelnen Gewerke unserer
Elektro- und Bautechniker sowie unserer
Betriebsleute zu einem Konzept zusammenfassen.
Die Bauplanungsunterlagen sind
soweit fertig, liegen prüffähig beim Bund."
Ärger mit dem “Neben-Verkehrssenator”
Generell einzufügen haben sich die Verkehrsexperten
der BVG in die gesamtheitliche
Verkehrsplanung des Landes Berlin, so
wie sie vom jeweiligen Senat und vom Parlament
beschlossen wurde. Mit dieser Einschränkung
ihrer Kompetenzen können und
wollen sie leben. Was das planerische Geschäft
aber enorm erschwert, ist, daß außer
der Senatverkehrverwaltung auch noch
andere Senatsressorts jeweils Teilzuständigkeiten
in Fragen der Planung beanspruchen.
Wenn diese Ressorts - wie in Berlin seit jeher
üblich - auch noch politischen Parteien
zugeordnet sind, gibt es jedoch “Reibungspunkte",
wie sich Schmidt im Gespräch zurückhaltend ausdrückt.
Zwar sei man “nicht
unzufrieden" mit der augenblicklichen Verteilung
der Zuständigkeiten, idealer wäre
aber sicherlich eine Zusammenfassung der
Planungskompetenzen unter dem Dach einer einheitlichen
Verwaltung für Stadtentwicklung und Verkehr. Ein
unausgesprochener Reibungspunkt waren in der Vergangenheit
die Versuche des ehrgeizigen Bausenators
Wolfgang Nagel (SPD), sich quasi
zum “Neben-Verkehrssenator" aufzuschwingen
und hinsichtlich der Prioritäten
beim Bahnbau eigene Akzente zu setzen.
Das Votum seiner Fraktion im Rücken plädierte
Nagel für eine beschleunigte Fortsetzung
des U-Bahn-Baus ins Märkische Viertel.
Demgegenüber sprach sich die BVG,
die bei den zu erwartenden geringen Fahrgastzahlen
auf dem Verlängerungsabschnitt
die enormen Kosten für nicht gerechtfertig
hielt, für den Vorrang beim S-Bahn-Ausbau
aus.
Daß dieser S-Bahn-Ausbau durch die
Schuld Nagels nur im “Schneckentempo"
vorrangeht, kritisert seit langem auch der
AL-Abgeordnete Michael Cramer. Er riet
den BVG-Planern jetzt, auf einen harten
“Konfliktkurs" zur immer noch von dem Senator
gelenkten Bauverwaltung zu gehen.
Sonst werde die S-Bahn "noch im nächsten
Jahrtausend" nicht auf allen Strecken fahren,
befürchtet der Abgeordnete.
Manchmal liegen die Planer des Eigenbetriebes
auch mit der eigenen Geschäftsleitung über
Kreuz. Das war beispielsweise im
Sommer letzten Jahres, als Direktor Lorenzen
laut darüber nachdenken ließ, den
durchgehenden Wochenend-Nachtverkehr
auf den U-Bahn-Linien 1 und 9 kurz nach
dem Start wieder einzustellen. Da hatte der
Senat gerade Etatkürzungen von 70 Millionen
DM verfügt. Unterdes sind die hauseigenen
Fachplaner immer noch davon überzeugt,
daß auch ein attraktiver Nachtverkehr auf
den Bahnen insgesamt die Fahrgastzahlen
und damit die Einnahmen steigen lasse.
Durchaus nicht unumstritten
blieb auch die von Lorenzen zum Thema
Straßenbahn-Ausbau vertretene Auffassung,
erst bei 20.000 Fahrgästen täglich sei
eine Strecke “stadtbahnwürdig“.
Sind Plane und Konzepte in der BVG-Bürokratie
Konsens, dann bleiben noch die Hürden der
allseits hochgehaltenen demokratischen
"Planungskultur“. Jedes BVG-Konzept muß
zunächst nach gut demokratischer
Sitte den Verkehrsausschüsslern im Abgeordnetenhaus
vorgetragen werden und bedarf, wie schon
erwähnt, der Zustimmung
der Abgeordneten. Als besonders aufwendiges
Unterfangen erwies es sich, in der Stadt
ein paar Kilometer neue Busspuren vom
Papier in die Realität umzusetzen. Die Vorschläge
wanderten erst zur Senatsverkehrsverwaltung,
dann zum Abgeordnetenhaus,
wurden in den teils widerspenstigen Bezirken
und beim Polizeipräsidenten noch und
noch gedreht und gewendet, bis sie letztendlich
mit vielen Änderungen oder Abstrichen
verwirklicht werden konnten. Nun ist
der mit allen Beteiligten gefundene Generalkonsens
wider in Frage gestellt, weil die
mittlerweile schwarz-rote Senatskoalition
vereinbarte, die selbst auf einer Länge von
gerade mal 39 Kilometern existierenden
Sonderfahrstreifen zu "überprüfen". Damit
dürfte das Stück aus dem Tollhaus der
West-Berliner Verkehrspolitik garantiert
seine ungute Forsetzung finden.
Am Anfang eine Mini-Abteilung
Zur Gründung einer eigenen Planungsabteilung
konnten sich die BVG-Oberen überhaupt erst
im Jahre 1969 durchringen. Sie
war zunächst der damaligen Direktionsabteilung
Verkehrsgestaltung zugeordnet, die
heute längst nicht mehr existiert, und beschränkte
sich streng auf Grundsatzfragen.
Mit der Gründung war die BVG “spät
dran", so Abteilungsleiter Schmidt.
Verkehrsunternehmen großer westdeuscher
Städte wie Hamburg und München, aber
auch Bremen und Hannover hätten eigentlich
immer schon derartige Fachabteilungen
gehabt. “Am Anfang bestand die Abteilung
aus zwei Personen, dann kam eine Schreibdame
dazu, da waren's drei", berichtet
schmunzelnd der 49-jährige, der seit sieben
Jahren Chef von nunmehr insgesamt 35
Mitarbeitern ist.
Nach den Angaben Schmidts werden heute
rund 40% der Planungsaufträge an Ingenieur- und
Beratungsfirmen sowie wissenschaftliche
Institute vergeben. Partner in
Berlin sind unter anderem die Studiengesellschaft
Nahverkehr (SNV) oder die Gesellschaft
für Informationsverarbeitung,
Verkehrsberatung und angewandte Unternehmensforschung
(IVU). Die IVU konzipierte so im
Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der
Wannseebahn eine rechnergestüzte Buslinienplanung. Ebenfalls von
der IVU entwickelt ist die Software für die
über 20 Persortalcomputer, die inzwischen
von den BVG-Verkehrsplanern selbst genutzt werden.
Um den städtischen Nahverkehr in Zukunft in
Griff zu behalten, soll
die EDV-Technik im Hause allerdings weiter
"aufgerüstet" werden. Die BVG-Verkehrsplaner sind,
wie im SIGNAL bereits
berichtet, feste dabei, ein rechnergestütztes
Betriebsleitsystem (RBL) zur Fahr- und
Dienstplangestaltung aufzubauen. Es soll
stufenweise in vier bis fünf Jahren eingeführt werden.
Datenloch im Osten
Bei allen langristigen Verkehrsprojekten in
der Region Berlin setzen sich die Planer im
übrigen einen Zeithorizont, der maximal bis
zum Jahre 2010 reicht. Nur für die Spanne
von längstens 20 Jahren gebe es nämlich
eine gesicherte Datenbasis, auf der sich einigermaßen
verläßliche Prognosen anstellen
ließen, führt Schmidt aus.
Bei der Zusammenfügung der BVG-Linien
mit denen der BVB und der Nahverkehrsunternehmen
im Umland stellen fehlende
Daten dennoch ein großes planerisches Problem dar.
Soweit dies das Gebiet des ehemaligen West-Berlin
betreffe, könne das
Statistische Landesamt, so Schmidt, immerhin für
jeden Block differenziert nach Geschlecht,
Lebensalter und Berufen detailierte Angaben
über die Bevölkerungsstruktur
liefern. Dazu gebe es Daten über das Gewerbe
und die Anzahl der Arbeitsplätze.
Ergänzend stünden die Ergebnisse einer eigenen
großen Haushaltsbefragung von 1986
mit sogenannten Quelle-Ziel-Erhebungen
zur Verfügung.
Anders die Situation im ehemaligen Ost-Berlin
und auf dem Gebiet der Ex-DDR:
Aus welchen Gründen auch immer hätten
die Statistiker dort nicht einmal ermittelt,
wieviel Beschäftigte an den verstreuten Produktionsstandorten
großer Kombinatsbetriebe arbeiten.
Schmidt zufolge registrierte
man die Arbeitsplätze unsinnigerweise am
jeweiligen Sitz der Kombinatsleitungen,
vielleicht aus Geheimhaltungsgründen.
“Eine Tragödie", meint der Planer Schmidt
sarkastisch: “Die eigentliche Planwirtschaft
haben interessanterweise wir."
Neue Planungsmaxime:
Der Fahrgast als "sinnliches" Wesen
Die weiter brachliegenden Nahverkehrsverbindungen
sind laut dem Abteilungsleiter
nur ein Faktor, der viele Autofahrer davon
abhält, auf Bahnen und Busse umzusteigen.
Eine Rolle spielt neben vielen anderen Dingen
sicherlich auch das von der BVG vor
Jahren verhängte Rauchverbot auf Bahnhöfen
und in Fahrzeugen, sagt Schmidt. Als
vorrangige Aufgabe einer neuen Verkehrsplanung
bezeichnet er deshalb die Beanwortung der
Gretchenfrage: “Was will der
Fahrgast wirklich?" Etwa bei den Fahrzeugen: Unter
anderem gebe es den Wunsch, in
neuen Nahverkehrszügen auf der Suche
nach freien Sitzplätzen von einem Waggon
in den anderen wechseln könne. In Zukunft
möchten die BVG-Planer jedenfalls hier die
Fahrgastwünsche stärker berücksichtigen.
Schon bevor man Firmen mit der Entwicklung
neuer Wagenbaureihen beauftrage,
sollten bezüglich der Raumgestaltung umfangreiche
Anforderungskataloge erstellt
werden, erklärt Schmidt. Noch bei der Konzeption
der neuen S-Bahn-Baureihe 480 sei
es demgegenüber im Grunde nur um die in
einem Lastenheft beschriebenen technischen
Kriterien gegangen; beispielweise
wie breit und hoch ein Wagen sein darf und
welche Stufenhöhe er haben muß.
Was die "Sinne" des Fahrgastes anspreche,
müsse weiter erforscht werden, denn die
BVG habe mit dem "Luxus des Individualverkehrs"
zu konkurrieren. Schmidt macht
indirekt deutlich, daß den Planern die Kritik
in den Knochen steckt, die BVG behandele
die Fahrgäste so wie Kartoffelsäcke, also als
anspruchsloses Transportgut. Der Vorwurf
der “Kartoffelsackideologie“ war von der
IGEB geäußert worden, als der vormalige
Verkehrssenatnr Horst Wagner sich anhand
von BVG-Angaben zur rechnerisch möglichen "Auslastung"
eines S- bzw. U-Bahn-Zuges äußerte und behausptete, Fahrgäste
wollten selbst bei freien Sitzen in der U-Bahn lieber stehen.
Daß in der Vergangenheit in Einzelfällen
an den Interessen der BVG-Kunden vorbeigeplant
wurde, räumen die Planer durchaus
ein. Alles andere als eine optimale Lösung
sei vor allem der derzeitige Kurzstreckentarif,
gab Schmidt zu. Man denke über eine
Änderung nach. Das komplizierte System
sei zu unübersichtlich, führe zu permanenten
Mißverständnissen zwischen den Buschauffeuren
und den Fahrgästen. In der
Folge gäbe es in den Bussen einen erheblichen
teil von "Graufahrern” - Leuten,
die nicht kapierten, daß die Kurzstrecke in
der Regel an der dritten Bahn- oder sechsten
Ommnibus-Haltestelle endet. Vorschlag
zur Abhilfe vom AL-Abgeordneten Cramer:
Einführung eines neuen Kurzstreckentarifs
mit lediglich einer zeitlichen Begrenzung
auf eine Stunde. Ob sich das rechnet, will
die BVG jetzt immerhin prüfen.
Wie Schmidt bestätigt, hat die BVG sich inzwischen
zu einer anderen Neuerung entschlossen: Ab
dem 2. Juni wird es nur noch
einmal im Jahr zu einem grundlegenden
Fahrplanwechsel kommen, und zwar Jeweils
zum Sommer, Zum Oktober sollten Änderungen
des Fahrplans nur noch eingeschränkt erfolgen,
sagt der BVG-Planungchef. Es reiche, die Fahrpläne
alle zwölf
Monate dem Bedarf anzupassen, da es heute
saisonale Schwankungen der Fahrgastströme
nur noch in Stadtrandbereiche
gebe und diese gegebenenfalls mit E-Wagen
aufgefangen werden könnten. Einleuchtender Leitgedanke
der BVG-Planer ist, ein relativ großes Bus-Grundnetz
einheitlich im
Zehn-Minuten-Takt zu bedienen, weil dies
am ehesten die Anschlüsse garantiert.
Thomas Knauf
Freier Jornalist
|

