Nach dem Amtsantritt von Verkehrssenator Strieder gab es neue
Hoffnungen. Doch nach einem Jahr überwiegen bei den Fahrgästen
Skepsis und Enttäuschung.
Preistreiberei ohne Ende?
 |
| Wiederholt werden die Stammkunden zur Kasse gebeten. Sollen im Durchschnitt die Preise um nur drei Prozent steigen, sind es bei den Monatskarten fünf Prozent. Der Berliner Fahrgastverband IGEB hält diese Steigerungen für fatal. Foto: Alexander Frenzel, Bahnhof Friedrichstraße, Oktober 2000 |
|
Die Inflationsrate ist seit Jahren niedrig.
Die Einkommen steigen nur geringfügig
oder gar nicht Aber die Fahrpreise von
Bahnen und Busse sollen auch in diesem
Jahr wieder um durchschnittlich drei Prozent
steigen. „Tarifstrukturanpassungen”
zum 1. April 2000 hatte der VBB-Aufsichtsrat
1999 beschlossen, Erhöhungen
sollte es im Jahr 2000 nicht geben. Dennoch
wurden die Fahrpreise zum 1. August 2000 erhöht.
Der Regierende Bürgermeister, Herr
Diepgen, und die Senatoren Strieder und
Branoner hatten sich gegen Tariferhöhungen
im Jahr 2001 ausgesprochen. Dennoch werden
die Fahrpreise zum 1. August 2001 erhöht.
Auf der Strecke bleibt
die Glaubwürdigkeit der Politik - und die
Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs.
Ein erheblicher Teil der VBB-Tarife
liegt inzwischen auf der Höhe oder sogar
noch über den Tarifen in den alten Bundesländern,
obwohl die Arbeitnehmer in Berlin und Brandenburg
10 bis 30 Prozent niedrigere Einkommen
haben als die in Hamburg, Düsseldorf oder
München.
Zu den Tarifplänen im Einzelnen
Die Verbilligung der Beriner Schüler-Monatskarte
von 60 DM auf 45 DM bzw. 30 DM ab
dem zweiten Kind ist ein großer Pluspunkt!
Dies trifft vor allem auf das
Angebot einer 30 DM-Karte zu. Mit der
45 DM-Karte, so richtig und wichtig dieser
Schritt ist, werden jedoch lediglich die
unverschämten Preistreibereien der letzten
Jahre korrigiert. So kostete eine Schüler-Monatskarte
1995 im Ostteil Berlins 39
DM und im Westteil 41 DM, und beide
Karten galten nicht nur im AB-, sondern
im ABC-Gebiet (also Berlin und Umland).
Die 45 DM-Karte bedeutet also gegenüber
1995 eine Verteuerung um zehn Prozent,
während die allgemeinen Lebenshaltungskosten
in Berlin seither um insgesamt fünf Prozent gestiegen sind.
 |
| Das Fahren mit Bahn und Bus wird in Berlin einmal wieder teurer. Foto: Alexander Frenzel, Dezember 2000 |
|
Fatal ist die erneute Verteuerung der
Monatskarten für Erwachsene. Ausgerechnet
die Stammkunden werden zum
wiederholten Male überdurchschnittlich
zur Kasse gebeten. So wird die Monatskarte
AB um fünf Prozent auf 110 DM
(Standard) bzw. 126 DM (Premium) verteuert.
Zum Vergleich: 1995 kostete die
Monatskarte (Premium, Standard gab es
noch nicht) 80 DM im Ostteil und 89 DM
im Westteil Berlins. Die Preissteigerungsrate
im Vergleich zu 1995 liegt also je
nach Karte bei 24 bis 58 Prozent!
Der Berliner Fahrgastverband IGEB ist
skeptisch, ob die neuen Angebote einer
Berlin-Card und einer Freizeitkarte nennenswert
nachgefragt werden oder gar
neue Kunden erschließen. Am ehesten
scheinen sie für Senioren interessant, für
die es bisher keine angemessenen Angebote
gibt. Aber gerade die Senioren werden
unter den Bedingungen der beiden
neuen Angebote zu leiden haben, da
stets (Berlin-Card) oder zeitweise (Freizeitkarte)
ein Ermäßigungsfahrschein zusätzlich
erworben werden muß. Das heißt:
Automat suchen, richtige Taste suchen,
Kleingeld suchen ...
Unbegreiflich ist die Abschaffung der
Kleingruppenkarte, noch unbegreiflicher
deren Begründung. Sie ist eine attraktive
Tageskarte für Gruppen bis zu fünf Personen,
also „Ausflügler und Touristen, Kaffeekränzchen
und Familien" (Zitat aus der
VBB-Werbung). Sie ist mit 21 DM für Berlin (AB)
im überregionalen Vergleich
schon jetzt besonders teuer. In Hamburg
kostet sie 13,80 DM (Montag bis Freitag
erst ab 9 Uhr gültig), in München 14 DM.
Das entspricht fast dem künftigen Preis
der Berliner Tageskarte für nur eine Person,
die ab 1. August 12 DM kosten soll.
Eine fünfköpfige Familie (mit Kindern
unter 14 Jahren) zahlt somit für einen Tag
in Berlin nach Abschaffung der Kleingruppenkarte
künftig 48,60 DM, eine fünfköpfige Familie
oder Gruppe Erwachsener 60
statt jetzt 21 DM!
 |
| Wie soll Tick.et in der Regionalbahn funktionieren? Darauf haben die Befürworter noch keine Antwort. Foto: RE am Bahnhof Friedrichstraße, Alexander Frenzel, September 2000 |
|
Deshalb protestiert der Berliner Fahrgastverband
IGEB auf das Schärfste gegen
die Abschaffung der Kleingruppenkarte,
die in fast allen Verbünden selbstverständlich
zum Tarifangebot gehört.
Zugleich sind wir bestürzt über die immer
wieder geäußerte Begründung, die Kleingruppenkarte
würde ohnehin vonrwiegend von Touristen genutzt. Erstens ist
das falsch, denn auch viele Berliner und
Brandenburger wissen das Angebot zu
schätzen. Zweitens ist es eine Begründung
mit fremdenfeindlichem Charakter,
womit sich Deutschlands Hauptstadt ein
denkbar schlechtes Zeugnis ausstellt.
Die zum 1. August geplante Tarifstruktur
verdient kaum noch diesen Namen.
Durch das Gefeilsche sind viele Merkwürdigkeiten
entstanden. Warum kosten ein
Einzelfahrschein AB und BC nun doch
wieder denselben Preis (4,20 DM), während
die Monatskarten BC stets teurer als
die Monatskarten AB sind? Warum werden
bei den Monatskarten die Karten AB,
BC und ABC teurer, bei den Jahreskarten
jedoch nur die Karten AB und BC, nicht
aber ABC?
Die Ungereimtheiten, vor allem aber die
erbitterten Schlachten im Vorfeld der Tariferhöhung
sind Ausdruck dafür, daß die
Verbundgesellschaft weiterhin nicht in
der Lage ist, so einen Prozess zu strukturieren
und zu moderieren. Das liegt nicht
nur an den Personen, sondern auch an
Konstruktionsmängeln in der Struktur des
Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg.
Deshalb fordert der Berliner Fahrgastverband IGEB,
daß die Verantwortung für
Struktur und Höhe der Tarife künftig allein
bei denen liegt, die ohnehin einen großen
Teil der Kosten tragen: bei den Ländern
bzw. Landkreisen. Bahn- und Bustarife
waren und sind politische Preise. Dazu
sollten sich alle bekennen.
Braucht Berlin „Tick.et", den
elektronischen Fahrschein?
Einen Versuch ist es Wert, das neue
„Tick.et". Aber vor einer Einführung sind
viele Fragen zu klären, nicht zuletzt die
der Kosten. Der Berliner Fahrgastverband
IGEB hat bereits anläßlich des "Tick.et"-Großversuches
im Jahr 1999/2000 deutlich gemacht, daß er der Einführung eines
elektronischen Fahrscheines im Raum des
Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg
aufgeschlossen gegenübersteht. Es müssen
jedoch unbedingt die Interessen der
Fahrgäste gewahrt werden. Insbesondere
für die heutigen Abonnementkunden, die
einen wesentlichen Teil der Fahrgäste darstellen,
darf es keine Verschlechterungen
geben, Deshalb definieren wir folgende
Anforderungen an ein künftiges elektronisches System:
Die Abtastung der Fahrausweise muß
aus der Entfernung erfolgen. Ein Ein- und
Auschecken, bei dem jedes Mal umständlich
eine Plastikkarte an einem Lesegerät
vorbeigeführt werden muß, ist im Massenbetrieb
nicht praktikabel und wird
daher von uns abgelehnt.
Es ist ein Kartensystem vorzusehen, das
zwei Möglichkeiten der Abrechnung bietet:
a) mit „aufgeladenen" Tickets ohne
die Preisgabe persönlicher Daten -
insbesondere für Gelegenheitskunden und Touristen,
b) mit Fahrscheinen, für die nachträglich - je
nach Inanspruchnahme - ein Preis in Rechnung gestellt wird.
Dies ist insbesondere für Dauerkunden von Bedeutung.
Das Tarifsystem muß für Vielnutzer Vorteile
bieten. Die mit dem elektronischen
Fahrschein mögliche „gerechtere" Fahrpreisermittlung
darf nicht dazu führen,
daß regelmäßige Fahrgäste mit astronomischen
Fahrgeldforderungen konfrontiert werden.
Eine Kappungsgrenze in
Höhe der heutigen Monatskartentarife
muß im Tarif festgeschrieben werden.
 |
| Der S-Bahnhof Kolonnenstraße im Dezember 2000. Foto: Alexander Frenzel |
|
Bei dem von uns favorisierten Tarifsystem
mit nachträglicher Entgeltabrechnung
sind erhöhte Anforderungen an
den Datenschutz zu stellen. So lange die
Erhebung von Straßenbenutzungsgebühren
bei Pkws mit dem Argument des Datenschutzes
abgelehnt wird, dürfen auch
von ÖV-Benutzern keine Bewegungsprofile
erstellt und gespeichert werden. Der
Tarif muß so übersichtlich und verständlich
bleiben, daß die Fahrgäste vor Fahrtantritt
problemlos erkennen können, wie
teuer die nachfolgende Fahrt für sie wird.
Wer will noch immer Zugangssperren bei der U-Bahn?
„Der Berliner Fahrgastverband IGEB wendet
sich mit Nachdruck gegen die Einführung
von Zugangssperren bei der Berliner
U-Bahn. Einen Nutzen haben ohne Zweifel
die Hersteller solcher Systeme, aber die
Fahrgäste haben nur Nachteile", schrieben
wir zur Jahrespressekonferenz 2000.
Das gilt auch 2001, Im Zusammenhang
mit dem elektronischen Fahrschein
„Tick.et“ und mit „Schwarzfahrerzahlen"
wird in Berlin seit einigen Jahren die Einführung
von mechanischen Zugangssperren
bei der Berliner U-Bahn diskutiert.
Beide Zusammenhänge sind konstruiert
und falsch:
Die Einführung des „Tick.et" erfordert
keine U-Bahn Zugangssperren. Das zeigte
der Probelauf. Und auch künftig würden
ja beispielsweise Bus und Straßenbahn
ohne Zugangssperren verkehren
müssen. Warum also sollten sie bei der U-Bahn
erforderlich sein?
- In Städten mit Zugangssperren gibt
es ähnlich hohe „Schwarzfahrerquoten” wie in Berlin.
- Die Kosten für Anschaffung und
Unterhalt der Zugangssperren können niemals „eingespielt" werden.
Ein Blick nach Paris
Die Pariser Verkehrsbetriebe RATP haben
nach eigenen Angaben bei der Metro -
trotz der Sperren - eine Schwarzfahrerquote
von vier bis fünf Prozent. Zum Vergleich:
bei der BVG waren es im Jahr 1998
3,4 und im Jahr 2000 drei Prozent. Auf
den insgesamt 297 Metrostationen (Berlin
hat 170 U-Bahnhöfe) gibt es insgesamt 3178 Sperren.
Der Unterhalt dieser
Sperranlagen kostet die RATP jährlich umgerechnet
rund 30 Millionen DM. Dies
führt unter anderem dazu, daß bei einem
Fahrpreis von zur Zeit rund 1,70 DM für
die Metro rund 0,60 DM für das System
benötigt werden. Statt Bahnhofsbarrikaden
zweite Zugänge auf den U- und S-Bahnhöfen!
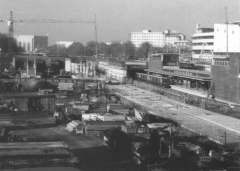 |
| Stichwort S-Bahn-Ringschluß: Auch dieser Termin rückt immer weiter nach hinten. Der jetzt genannte Termin 2003 wird sicherlich nicht der letzte sein. Foto: Frank Böhnke, November 1999 |
|
Der Berliner Fahrgastverband fordert
alle Verantwortlichen auf, die kostenträchtigen
Planspiele für U-Bahn-Zugangssperren sofort zu beenden und
stattdessen alle diejenigen U- und S-Bahnhöfe
mit einem zweiten Ausgang zu
versehen, wo dieser bislang fehlt. Dazu
zählt nicht nur Deutsche Oper, sondern
auch die U-Bahnhöfe Sophie-Charlotte-Platz
und Schillingstraße oder die S-Bahnhöfe
Tempelhof und Olympiastadion.
Zum einen gibt es damit einen zweiten
Fluchtweg, zum anderen werden viele
Stadtteile so besser an den OPNV angeschlossen.
Vor diesem Hintergrund begrüßt der
Berliner Fahrgastverband IGEB
das diesjährige 15 Millionen DM-Programm
für den Bau neuer Zugänge und
Aufzüge auf S-Bahnhöfen.
S-Bahnhof Kolonnenstraße -
wie lange sollen wir denn noch
warten?
Rund um die Schöneberger Kolonnenstraße
wohnen und arbeiten viele tausend
Menschen. Seit 15 Jahren wird Ihnen
der Bau eines S-Bahnhofes an der
Wannseebahn versprochen. Doch sie
müssen noch immer warten. Seit 1989
wurde den Fahrgästen immer wieder ein
bevorstehender Baubeginn für den S-Bahnhof
Kolonnenstraße an der S1 angekündigt,
doch passiert ist bis heute nichts,
Selbst bei der umfänglichen Sanierung
der Wannseebahn im August 2000 wurden
noch keine Vorbereitungen für den
Bahnsteigbau getroffen, 1944 war der
alte Bahnhof der Wannseebahn an der
heutigen Julius-Leber-Brücke geschlossen
und danach nicht mehr in Betrieb genommen
worden. Seitdem fährt die S-Bahn ohne
Halt durch das dicht bebaute
Gebiet an ihren Fahrgästen vorbei. Auch
für die Geschäfte am Kaiser-Wilhelm-Platz
wäre der Bahnhof Kolonnenstraße günstig
gelegen. Derzeit wird als Eröffnungstermin
für den neuen S-Bahnhof der
Sommer 2003 genannt. Doch bahnintern
wird schon wieder bezweifelt, daß dieser
Termin zu halten ist.
Der Berliner Fahrgastverband IGEB verzichtet
auf Beschreibungen der offiziellen
und auf Spekulationen zu den inoffiziellen
Gründen für die immer neuen Verzögerungen.
Die Fahrgäste interessiert nur
noch, daß endlich mit den Bauarbeiten
angefangen wird, und daß der Bahnhof
schnellstens eröffnet wird. Wie viele Jahre
wollen Senat und Bahn diese besonders
peinliche Ausgabe der unendlichen
Geschichte denn noch fortsetzen?
Bedarfsplan - Warum macht
der Verkehrssenator nicht
seine Hausaufgaben?
Laut § 5 des Berliner ÖPNV-Gesetzes sind
ein Bedarfsplan für den öffentlichen Personennahverkehr
und ein Nahverkehrsplan aufzustellen.
Sechs Jahre nach Erlaß
des Gesetzes gibt es beide Pläne noch
nicht. Was sind die Aufgaben von Bedarfs- und
Nahverkehrsplan? In § 5 des
Berliner ÖPNV-Gesetzes wird dazu ausgeführt:
Der Bedarfsplan „umfaßt die langfristigen
Planungen für die Schieneninfrastruktur und
andere bedeutsame lnvestitionsmaßnahmen
des öffentlichen Personennahverkehrs."
Im „Nahverkehrsplan
sind (...) Ziele und Rahmenbedingungen
für das betriebliche Leistungsangebot
festzulegen." Wer also trotz gesetzlichem
Auftrag beide Pläne nicht fertigstellt,
scheut offensichtlich die Verbindlichkeit
dieser Pläne und will weiter mauscheln
wie bisher. Das war bei Verkehrssenator
Jürgen Kleman offensichtlich. Warum
setzt Peter Strieder diesen Kurs fort?
Beim Nahverkehrsplan fand der neue
Senator Stückwerk vor, das mit seinen
verkehrspolitischen Vorstellungen nicht
vereinbar war. Hier wurde eine gründliche
Überarbeitung unter Einbeziehung Dritter
begonnen, und die bisherigen Ergebnisse
Dönnen überwiegend positiv gewertet
werden. Es gibt allerdings einen Mangel:
Um das Betriebsprogramm bestimmen zu
können, sollte zuvor das Investitionsprogramm
feststehen. Deshalb sollte der Bedarfsplan
vor dem Nahverkehrsplan verbindlich
beschlossen werden. Ansonsten
müssen im Nahverkehrsplan Aussagen zu
Verkehrsleistungen getroffen werden, deren
Realisierung nicht für alle nachvollziehbar
und verbindlich festgelegt ist.
In der Senatsverkehrsverwaltung heißt
es, die Arbeiten am Bedarfsplan würden
praktisch ruhen. Warum? Hat der Senator
seine Verwaltung nicht im Griff? Oder will
Herr Strieder die Mauschelpolitik seines
Vorgängers fortsetzen? Der Berliner Fahrgastverband
IGEB fordert den Verkehrssenator auf, alle
Spekulationen zu unterbinden, indem er
schnellstens den gesetzlichen Auftrag erfüllt
und einen Bedarfsplan präsentiert - und beschließen läßt.
Straßenbahnausbau im
Schneckentempo
Kein Schienenverkehrsmittel kann so
schnell und preiswert ausgebaut werden,
wie die Straßenbahn. Andere Städte haben
das bewiesen. Nur in Berlin kommt
der Straßenbahnausbau nicht voran. Seit
der Wiedervereinigung Berlins hat sich die
Stadt nur sehr langsam auf die Qualitäten
der Straßenbahn besonnen. War anfangs
sogar die Einstellung der Straßenbahn im
Gespräch, so begann Mitte der 90er Jahre
die umfassende Sanierung des bestehenden
Netzes - und eine allerdings äußerst
bescheidene Netzerweiterung. Hierbei
gab es bisher nur eine einzige Streckenverlängerung
in den Westteil. Dies ist
im Jahre 2001 eine beschämende Bilanz.
Der Berliner Fahrgastverband IGEB begrüßt
die Absicht des Stadtentwicklungsplanes
Verkehr, der Straßenbahn endlich
„freie Fahrt in ganz Berlin" zu geben. Allerdings
sind die Planungen, was bis zum
Jahr 2005 realisiert werden soll, vollkommen
unzureichend. Außerdem sind wieder
ausschließlich Bauten im Ostteil Berlins
vorgesehen. Die Chance, durch die
Verzögerung des U5-Baues mehr Gelder
für den Straßenbahnausbau zur Verfügung
zu haben, wird offensichtlich vertan.
Daher fordert der Berliner Fahrgastverband
IGEB den Verkehrssenator auf,
den Ankündigungen zur Straßenbahn
endlich auch konkrete Planungen und
Bauarbeiten folgen zu lassen. Eine hohe
Attraktivität und deshalb Priorität haben
für die Fahrgäste folgende Strecken:
- vom Alexanderplatz in die Leipziger
Straße in Richtung Kulturforum
und darüber hinaus,
- Verlängerung der Linie 20 auf der
Bernauer Straße über den Nordbahnhof
auf die Invalidenstraße bis
zur Sandkrugbrücke (Teilinbetriebnahme
in Richtung Lehrter Fernbahnhof
vor dessen Inbetriebnahme).
- Verlängerung der bisher am Virchow-Klinikum
endenden Neubaustrecke mindestens bis S-Bahnhof
Beusselstraße,
- Verlängerung vom S-Bahnhof Warschauer
Straße über die Oberbaumbrücke in Richtung Hermannplatz,
- Baubeginn für die Südtangente als
Ersatz für den X 11 auf dem Abschnitt S-Bahnhof Schöneweide
zum U-Bahnhof Zwickauer Damm;
dieses Projekt sollte zeitgleich mit
dem Bau einer Straßenbahnstrecke
über den Groß-Berliner Damm vom
Bahnhof Schöneweide in Richtung
Adlershof erfolgen.
Umständliches Umsteigen
 |
| Die Erneuerung des Berliner Straßenbahn-Fahrzeugparks ist inzwischen abgeschlossen. Wann wird es Verbesserungen beim Umsteigen zwischen Bahn und Bus geben? Foto: Marc Heller |
|
Weite und beschwerliche Umsteigewege
machen die Benutzung von Bahnen und
Bussen oft unattraktiv. Das will der Verkehrssenator
ändern - bisher vergeblich.
Denn die Macht der Berliner Autolobbyisten
und versierten Bedenkenträger ist
ungebrochen. Seit vielen Jahren weist der
Berliner Fahrgastverband IGEB auf lange
Wege, Unbequemlichkeiten und Gefährdungen
für umsteigende Fahrgäste hin.
So wurden nach IGEB-Anregungen im
vorigen Jahr die Umsteigewege am S-Bahnhof
Lichterfelde West zwischen S-Bahn und
Bus entscheidend verkürzt, Allerdings
hatte der Fahrgastverband bereits 1985 (!)
bei der Wiederinbetriebnahme der Wannseebahn
auf diesen Mißstand hingewiesen. Am S-Bahnhof Tegel
haben nun alle Beteiligten versprochen,
dass spätestens zum Juni 2001 die Buslinie
133 eine Haltestelle am S-Bahnhof
enthält. Doch Zweifel sind angebracht,
denn noch immer hängt dieses Vorhaben
in der Planungsphase fest.
Auf Grund der offensichtlichen Mißstände
und der IGEB-Anregungen hatten
sich Verkehrssenator Peter Strieder und
seine Staatssekretärin Maria Krautzberger
entschlossen, eine Plattform „Umsteigebeziehungen"
bei der Senatsverkehrsverwaltung
zu gründen, an der alle zuständigen
Verwaltungen und Interessenvertretungen
beteiligt sind. Leider hat die-
se Plattform die in sie gesetzten Erfahrungen
bis jetzt nur unzureichend eingelöst.
Bis jetzt setzten sich auch in der Plattform
wieder die hinlänglich bekannten
Berliner Bedenkenträger durch. Im Zweifel
hat das Auto immer noch Vorrang vor
den ÖPNV-Fahrgästen. Da werden P+R-Parkplätze,
die nur einer Minderheit zu
Gute kommen, ins Feld geführt, um die
Verlegung von Bushaltestellen zu verhindern,
was mehr Fahrgästen nützen würde.
Oder aber die Durchlaßfähigkeit einer
Straße für Taxis hat eine höhere Priorität,
als das Neuanlegen einer Haltestelle, um
Umsteigewege zu verkürzen. Senator
Strieder muß aufpassen, daß der verdienstvolle
Ansatz nicht unterlaufen wird.
Bisher zeichnet sich ab, daß bestenfalls einige
Feigenblatt-Projekte realisiert werden
können. Zur selben Zeit gab es an einem
wichtigen Umsteigepunkt sogar eine
Verschlechterung. Das Umsteigen am
neuen U-Bahnhof Pankow in die Straßenbahnen
Richtung Norden ist bisher äußerst
unattraktiv. Die Fahrgäste wurden
auf die Zukunft (neue Straßenbahnhaltestelle
nach Neubau der Bahnbrücken) vertröstet
und suchten sich einen eigenen
Weg. Hilflose Reaktion des bezirklichen
Tiefbauamtes: Aufstellen von Gittern. IGEB
|

