Einleitung
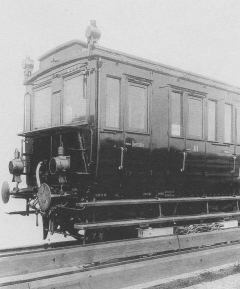 |
| Elektrischer Versuchszug aus dem Jahre 1903 für die Strecke Potsdamer Bahnhof — Lichterfelde Ost. Foto: Werkfoto AEG |
|
Die Viaduktstrecke der Berliner Stadtbahn stellt nicht nur die erste ihrer
Art in Europa dar, sondern auch die für die Stadtentwicklung Berlins
bedeutendste Verkehrsader. Die 1882 fertiggestellte viergleisige
Eisenbahnstrecke mit je einem Gleispaar für den Lokal- und dem Fernverkehr
sorgt bis heute für stetige und schnelle Verbindungen zwischen dem Osten
und dem Westen der Stadt. Immer wieder gab es Veränderungen und Erneuerungen
an dieser wichtigen Strecke. Die Gründe hierfür waren und sind vielfältig:
Da gab es Verschleiß aufgrund der hohen Beanspruchung und der Schäden durch
Rauchgase der Dampflokomotiven, notwendige Modernisierungen/Erweiterungen
wegen der hohen Zahl von Reisenden und Zügen (wie beim Bahnhof Friedrichstraße),
konstruktive Fehler oder neue Techniken und ihre Anforderungen an Strecke und
Bauwerke. Schließlich galt es Kriegsschäden oder die Folgen der - ebenfalls
durch Baumaßnahmen begleiteten - Teilung zu beseitigen. In den letzten Jahren
wurden nicht nur die Folgen der jahrzehntelang vernachlässigten Instandhaltung
und Modernisierung beseitigt. Vielmehr soll die Stadtbahn am Ende der
Baumaßnahmen für die technischen und betrieblichen Anforderungen des 21.
Jahrhunderts gerüstet sein.
Schon einmal, in den zwanziger Jahren, gab es umfassender Veränderungen an
der Berliner Stadtbahn. Sie standen im baulichen Umfang und den daraus
erwachsenden Konsequenzen für den Betrieb den jetzt abgeschlossenen Maßnahmen
in nichts nach. Dabei ging es zum einen um nachfolgende Instandsetzungs- und
Erweiterungsmaßnahmen an Viadukten und Bahnhöfen, zum anderen um die
Elektrifizierung der Stadtbahn- (das heißt S-Bahn-)Gleise. Am 11. Juni 1928
war es soweit: Der regelmäßige elektrische Betrieb mit neuen, modernen Zügen
konnte beginnen, die Dampflokära war vorbei. Ein wichtiger Schritt, Berlin
mit einem der modernsten Nahverkehrssysteme der Welt auszustatten, war getan.
Die lange Vorgeschichte
Die ersten Vorstöße, den schwerfälligen und aufwendigen Dampfbetrieb durch
elektrische Fahrzeuge zu ersetzen, reichen weit zurück. Schon 1888 legte
Siemens einen Plan zur Elektrifizierung der Stadtbahn vor. Diese Pläne
stießen zunächst nicht auf Gegenliebe. Die Preußische Eisenbahn Verwaltung
setzte - nicht zuletzt durch Einflußnahme ihrer Lokomotivlieferungen - auf
die weitere Verbesserung der auf der Stadtbahn eingesetzten Dampfloks.
Elektrische Zugförderung auf den Gleisen der Eisenbahn in und um Berlin blieb
so zunächst auf Versuche der Industrie beschränkt. Das Unternehmen Siemens
und Halske richtete 1900 - 1902 auf den Gleisen der Wannseebahn zwischen
Potsdamer Bahnhof und Zehlendorf einen Versuchsbetrieb ein, der der späteren
S-Bahn schon recht nahe kam: Gleichstrombetrieb mit seitlicher Stromschiene.
Einen ähnlichen Betrieb richtete die AEG 1903 auf der Strecke Potsdam
Bahnhof - Lichterfelde Ost ein. Er hielt sich bis zur Anpassung an
das Berliner S-Bahn-Netz im Jahre 1929.
1903 bis 1905 wurde auf der Strecke Niederschöneweide - Spindlersfeld
ein Versuchsbetrieb mit Einphasenwechselstrom durchqeführt.
Spektakulär waren die 1903 auf der Königlichen Militär-Eisenbahn
durchgeführten Hochgeschwindigkeitsfahrten zwischen Marienfelde und Zossen.
Walter Reichel aus dem Hause Siemens forderte 1907 nachdrücklich die
Elektrifizierung der Berliner Stadtbahn nach Hamburger Vorbild. Dort
wurde mit 6000 Volt Wechselstrom „elektrisiert". Angesichts
der gestiegenen Beförderungsleistungen der an ihrer Kapazitätsgrenze
angelangten Stadtbahn legte die Königliche Eisenbahndirektion 1909 ein Konzept
zur Elektrifizierung mit 10.000 Volt und 15 Hertz vor. Nach langen politischen
Auseinandersetzungen beschloß der Landtag 1913 ein Gesetz zur Elektrifizierung
der Stadt- und Ringbahn. Um zu Aufschlüssen über die günstigste Betriebsart
zu kommen, hatte die Eisenbahndirektion auf der bereits 1910/1911
elektrifizierten Strecke Dessau - Bitterfeld Versuche unternommen. Nach
kriegsbedingter Einstellung des dortigen elektrischen Betriebs am 1. August
1914 wurden die Versuche auf den schlesischen Strecken Hirschberg - Königszelt
und Niedersalzbrunn - Halbstadt fortgesetzt.
Grundgedanke war, die alten Abteilwagen weiter zu benutzen. Neben dem Einsatz
elektrischer Lokomotiven wurde die Verwendung von Triebdrehgestellen erwogen.
Nach Ende des Ersten Weltkrieges wurden Vorarbeiten für die Elektrifizierung
mit Wechselstrom wieder aufgenommen. Anfang 1921 war aus wirtschaftlichen
Gründen ein Umdenken zu verzeichnen. Der wachsende Einfluß der
Elektroindustrie spielte dabei sicherlich eine Rolle.
Die „Elektrisierung" sollte nun nach dem bereits auf den Strecken nach
Zehlendorf und Lichterfelde sowie auf der Hoch- und Untergrundbahn bewährten
Prinzip mit Gleichstrom und seitlicher Stromschiene erfolgen. Die technische
Ausrüstung der Wagen war einfacher, auch konnte man die Stromversorgung an
das öffentliche Netz anschließen und war nicht zum Bau eigener Bahnkraftwerke
gezwungen. Dafür wurde in Kauf genommen, kurze Speiseabschnitte anlegen
zu müssen.
Eine neue Fahrzeuggeneration wurde entworfen, die die nach
jahrelangem Einsatz verschlissenen Abteilwagen ersetzen sollte.
1922 begannen die Arbeiten zur Elektrifizierung durch den Bau der
Gleichrichterwerke. Am 8. August 1924 wurde zwischen dem damaligen Stettiner
Bahnhof und Bernau der regelmäßige elektrische Betrieb aufgenommen.
Dies war quasi der "Geburts-Tag" der Berliner S-Bahn.
Die Sanierung der Stadtbahn 1918 - 1933
 |
| S-Bahn auf Fernbahngleisen zwischen Bode- und Pergamonmuseum während der Stadtbahn-Sanierung 1995. Foto: Marc Heller |
|
Vor der mit der "Elektrisierung" verbundenen umfassenden Modernisierung und
Attraktivierung der Stadtbahn standen dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen
an Bahnhöfen, Viadukten, Bögen und Brücken. Die sich bereits wenige Jahre
nach der Eröffnung 1882 einstellenden Bauschäden nahmen immer mehr zu -
bedingt durch die voranschreitende Zeit, den zunehmenden Zugverkehr, die
größeren Achslasten der Lokomotiven und die infolge des Ersten Weltkrieges
vernachlässigten Instandhaltung. Sollte die Stadtbahn weiterhin als zentrale
Strecke des Nah- und Fernverkehrs erhalten bleiben, war eine umfassende
Sanierung der Viaduktbögen, eine Auswechselung der stählernen Hallen
und Brücken sowie eine punktuelle Erweiterung der Bahnanlagen,
insbesondere für den Fernverkehr, unumgänglich.
Die Baumaßnahmen umfaßten:
- Sanierung nahezu aller Viadukte zwischen dem heutigen Ostbahnhof und dem
S-Bahnhof Savignyplatz
- Neubau aller Brücken über Straßen (zum Teil auch in Bahnhofsbereichen) und
Gewässer mit teilweise umfangreichen Neufundamentierungen und punktuell
Ersatz von steinernen Viadukten durch
stählerne Brücken konstruktionen (zum Beispiel am Bahnhof Jannowitzbrücke).
Bei diesen umfangreichen Maßnahmen kamen neue Bautechniken zur Anwendung,
und es hielt gleichzeitig eine neue Gestaltung Einzug, insbesondere der
Bahnhöfe. Vor allem die neuen Stützenkonstruktionen
aus Stahl und Beton ermöglichten eine wesentlich offenere und freiere
Raumaufteilung der Bahnhofsanlagen. Dem gründerzeitlichen Muff mit seinen
historisierenden Formen folgte expressive Gestaltung oder die klare
schnörkellose Sprache der Neuen Sachlichkeit.
Die wichtigsten Maßnahmen im einzelnen:
Schlesischer Bahnhof, der heutige Ostbahnhof: völlige Erneuerung
der beiden stählernen Hallenkonstruktionen.
Jannowitzbrücke: Neubau auf einem sanierten und erweiterten Viadukt,
Bau eines Umsteigebahnhofs zur U-Bahn.
Alexanderplatz: umfassende Modernisierung der Empfangsräume,
Neubau der Bahnsteighalle und Verknüpfung des Stadtbahnhofes
mit der U-Bahn.
Börse: Sanierung der Bahnsteighalle, Neubau der nahegelegenen
Brücken über die Museumsinsel.
Friedrichstraße: Wiederaufnahne der vor dem Ersten Weltkrieg
begonnenen Erneuerung und Erweiterung der Anlage auf sechs Gleise,
Verknüpfung mit der U-Bahn.
Lehrter Bahnhof: umfassende Sanierung der Stützen- und
Brückenkonstruktion, Sanierung der Bahnsteighalle.
Bellevue: Sanierung der Bahnsteighalle, Neubau der angrenzenden
Spreebrücke.
Tiergarten: Erneuerung der nahegelegenen
Brückenanlagen am Landwehrkanal.
Baumaßnahmen im Rahmen der Elektrifizierung
 |
| Stadtbahn-Sanierung 1995: Bau der „Festen Fahrbahn” für die S-Bahn am Bahnhof Friedrichstraße Foto: Dirk Riediger |
|
Da die neuen Triebwagen für den elektrischen Betrieb eine andere Fußbodenhöhe
besaßen als die alten preußischen Abteilwagen und zugleich durch stufenfreies
Ein- und Aussteigen der Fahrgastfluß verbessert werden sollte, war es
erforderlich, die Bahnsteige anzuheben. Ihre Höhe wurde von 76 cm auf
96 cm über Schienenoberkante verändert. Auf den meisten Bahnsteigen
wurden in diesem Zusammenhang alle Aufbauten (Diensträume, Warteräume,
Kioske etc.) erneuert und das bisherige Erscheinungsbild der Anlagen
dadurch z.T. erheblich verändert.
Die umfangreichste Baumaßnahme im Rahmen der Stadtbahn-Elektrifizierung
war der Bau des S-Bahnhofs Ausstellung westlich von Charlottenburg in den
Jahren 1927-29 nach Plänen des Reichsbahnarchitekten Richard Brademann.
Mit der Anlage dieses Bahnhofes - seit 1932 "Westkreuz" genannt -
wurden mehrere Ziele verfolgt:
- Verbesserung der Umsteigesituation zwischen der Stadtbahn, der
Ringbahn und der Spandauer Vorortstrecke durch Schaffung eines
Umsteigebahnhofes unmittelbar an der Kreuzung der verschiedenen Linien
- bessere Erschließung des damals neuen Ausstellungsgeländes der
Stadt Berlin. Hierfür wurde an der Spandauer Vorortstrecke
zusätzlich der Bahnhof Eichkamp angelegt
- Neuordnung der Gleisanlagen für Vorort-und Fernverkehr im Raum
westlich von Charlottenburg.
Insgesamt konnte durch diese Maßnahmen das Bahnangebot und die
Umsteigesituation am westlichen Ende der Stadtbahn deutlich
verbessert werden.
Die Stromversorgung
Die Elektrifizierung erforderte umfangreiche technische und hochbauliche
Veränderungen der Bahnanlagen. Die S-Bahn übernahm den Strom von den
Kraftwerken der BEWAG bzw. dem damaligen mitteldeutschen Verbundnetz (EWAG)
als Drehstrom mit 30.000 Volt Spannung an zwei Stellen im Osten und im
Westen, an den wichtigen Punkten, wo die Stadtbahn und der Ring sich
schneiden. Als Übernahmestellen und als zentrale Überwachungs- und
Steuerungsstelle entstanden zwei Schaltwarten neu: in Halensee und am
Markgrafendamm (am S-Bahnhof Ostkreuz). Von dort wurde und wird der
Drehstrom durch 30.000-Volt-Kabel über das ganze Bahnnetz verteilt
und den einzelnen längs der Strecke angeordneten Unterwerken zugeführt.
In den Unterwerken befinden sich die Anlagen, mittels deren
Drehstrom mit 30.000 Volt in Gleichstrom umgewandelt wird.
Während in den Werken der Vorortlinie die Leistung für größere
Streckenabschnitte vereinigt ist, wurde für die Stadt- und Ringbahn die
verteilte Speisung mit Fernsteuerung gewählt. Die ganze Strecke wurde in
viele kurze Teilstrecken aufgeteilt, von denen 30 von je einem kleinen
Gleichrichterwerk mit je zwei Gleichrichtersätzen gespeist werden. Von
diesen Werken konnten acht in Stadtbahnbögen untergebracht werden. So
war es möglich, im dicht bebauten, wertvollen Innenstadtgebiet auf
eigenständige Bauten für die Stromversorgung der S-Bahn zu verzichten.
Um die notwendigen Kabel zwischen den Unterwerken unterzubringen, entstanden
entlang des Viaduktes Kabelkanäle, die zugleich als Weg für Wartungspersonal
ausgeführt wurden. Ein Kabelkanai führte die Starkstromkabel für die
Energieversorgung. Der andere war für die Aufnahme der Schwachstromkabel
(z.B. für die neuen elektrischen Signale) erforderlich.
Die notwendige Freimachung des Lichtraumprofils für die Durchführung der
Stromschienen und Stromabnehmer war insbesondere bei den bestehenden
Brückenbauwerken mit Schwierigkeiten verknüpft. Obwohl die Bauart des
Stromabnehmers es zuläßt, in gewissen Grenzen in der Senkrechten
und Waagerechten auszuweichen, mußten in vielen Fällen Gleishebungen
und Verschwenkungen sowie Änderungen der Eisenkonstruktionen von
Brücken vorgenommen werden.
Die neuen Fahrzeuge
 |
| Zug der Baureihe 481 der Berliner S-Bahn auf der Kupfergraben-Brücke vor der Einfahrt in den Bahnhof Friedrichstraße Foto: Marc Heller |
|
Nachdem Anfang der 20er Jahre die Entscheidung zur Elektrifizierung der
Strecken der Berliner Stadt-, Ring- und Vorortbahnen mit Gleichstrom und
zur Neubeschaffung von Triebwagen gefallen war, wurden zunächst antriebslose
Versuchszüge in Auftrag gegeben. Mit ihnen sollte die optimale Form des
Einstiegs und des Grundrisses im Wageninnern gefunden werden. Die Züge
kamen ab dem 8. August 1924 auf der Strecke vom Stettiner Vorortbahnhof
nach Bernau zum Einsatz. Basierend auf den Versuchszügen entstand die
erste Fahrzeugserie der S-Bahn weitgehend an den Versuchszug A angelehnt.
Von dieser Serie wurden 17 Einheiten ausgeliefert, die Bauart „Bernau"
(später ET/EB 169). Die Eröffnung weiterer Strecken machte erneute
Fahrzeugbeschaffungen erforderlich. Diese Bauart „Oranienburg"
(später ES/ET/EB 168) bestand aufgrund der gesammelten Erfahrungen nicht
mehr aus „Halb"-Zügen (fünf Wagen) als kleinster Zugeinheit, sondern aus
Einheiten mit je einem Trieb- (ET) und einem Steuerwagen (ES). Damit
wurde es möglich, variabler auf den Platzbedarf zu reagieren. 50 Stück
dieser Einheiten wurden geliefert.
Von 1927 bis 1930 wurde eine weitere Fahrzeuggeneration in Betrieb genommen.
Notwendig war ihre Beschaffung durch die „Große Elektrisierung" von Stadtbahn,
Ringbahn sowie den meisten anderen, bis dahin mit Dampf betriebenen
Vorortbahnen. Ihr Ersteinsatz auf der Berliner Stadtbahn brachte den Zügen
ihren Namen: Bauart „Stadtbahn". Gegenüber der Bauart Oranienburg wurde eine
Reihe von konstruktiven und kleineren Verbesserungen durchgeführt. Die
Bauart „Stadtbahn" wurde nicht nur zur meistgebauten deutschen Fahrzeugserie
überhaupt, sondern auch zu der „S-Bahn" schlechthin. Die ihr in den
verschiedenen Jahrzehnten nachfolgenden Fahrzeugtypen basierten alle auf
ihrem Gesamtkonzept. Noch rund 70 Jahre nach ihrem ersten Einsatz, sind
Züge der Bauart Stadtbahn in Betrieb - wenn auch vielfach grundüberholt
und soweit modernisiert, daß sie mit ihren Vorfahren als charakteristischstes
Merkmal nur noch die Nieten gemeinsam haben.
Betriebliche und ökonomische Auswirkungen
Die wechselhaften Jahre nach dem Ersten Weltkrieg brachten erhebliche
Schwankungen in den Fahrgastzahlen der Berliner Nahverkehrsmittel. Der
Anteil der Stadt-, Ring- und Vorortbahnen (erst ab 1.12.1930 hieß es
"S-Bahn") ging dabei beständig zurück. Dr.-Ing. Remy, ein leitender
Mitarbeiter der Deutschen Reichsbahn, notierte 1931 rückblickend
viele Gründe:
„...Seit dem Jahr 1907 versahen dieselben Lokomotiven den Dienst. Die Wagen
hatten ein Alter bis zu 46 Jahren. Jede bauliche Verbesserung hatte man
mit Rücksicht auf die kommende Elektrisierung und die schwebenden
Groß-Berliner Verkehrspläne verschoben. Die Stadtbahnhöfe mit den dunklen
Zugängen, der teils sehr ungünstigen Lage zu den Verkehrsströmen, mit den
hohen Treppen übten eine mehr abstoßende als anziehende Wirkung aus. Man
mied die Stadtbahn. Inzwischen aber hatten Hoch- und Untergrundbahnen mit
ihrem erweiterten Netz, den bequem gelegenen Haltestellen, die Straßenbahnen
mit den sorgfältig ausgestatteten Wagen, eine rationalisierte
Streckenbedienung der Straßenbahnlinien, eine mit großen Mitteln
unterstützte Ausdehnung des Omnibusbetriebs die Stadt- und Ringbahnlinien
auf vielen Teilstrecken aus dem Feld geschlagen..."
Die Elektrifizierung - verbunden mit umfangreichen Modernisierungen - sollte
hier eine Wende bringen. Dazu Dr.-Ing. Remy:
"1. Die Beschleunigung der Personenbeförderung
Die Reisegeschwindigkeit konnte durch die elektrische Zugförderung
vermöge der hohen Anfahrbeschleunigung erhöht werden. Die
Höchstgeschwindigkeiten betrugen im Dampfbetrieb auf der Stadtbahn 45 km,
auf der Ringbahn ebenfalls 45 km, auf den Vorortstrecken 60 km. Sie wurden
erhöht je auf 55 km, 65 km und 75 km. Die Reisegeschwingkeit betrug auf
der Stadtbahn beim Dampfbetrieb 22 km, sie wurde erhöht auf 31 km/Std,
auf dem Ring von 24 auf 33 km, auf den Vorortstrecken von 30 km auf 35
bis 43 km.
2. Vermehrung der Zugzahl. Verdichtung der Zugfolge
Die Zugzahl in der Stunde auf der am dichtesten belegten Strecke, der
Stadtbahnstrecke, war bisher 24, ausnahmsweise 26. (...). Durch den
elektrischen Betrieb war die Möglichkeit geschaffen, 40 Züge in der
Stunde zu fahren. Diese Zugvermehrung läßt also auf der Stadtbahn einer
Entwicklung Raum, die in einer Stunde in einer Richtung die Beförderung
von 40 mal 1208 = rund 50.000 Personen, in Ausnahmefällen von
64.000 Personen ermöglicht. In den Dampfzügen konnten 24-27.000
Fahrgäste befördert werden...
3. Steigerung der Leistungsfähigkeit duch vergrößerte Aufnahmefähigkeit der Züge
Die Aufnahmefähigkeit der Züge war durch eine (...) günstigere Verteilung
der Sitz- und Stehplätze bei dem Ganzzug auf 1200 -(...) 1600
Personen zu steigern.
 |
| Stadtbahn neu und neuer: Der Pressezug anläßlich der Wiederaufnahme des Fernverkehrs über die Stadtbahn neben einem S-Bahn-Zug am 20. Mai 1998 im Bahnhof Alexanderplatz. Foto: Marc Heller |
|
4. Größere Annehmlichkeit für die Reisenden. Vorteile für die Sicherheit
Beseitigung der Rauch- und Rußplage galt schon immer als eine der größte
Annehmlichkeiten des elektrischen Betriebs. Sie kommt nicht nur dem Reisenden
zustatten, sondern wirkt sich auch im Betrieb fördernd und wirtschaftlich
aus. (...) Im Verein mit der Umgestaltung des Betriebs war die Erhöhung
der Bahnsteige möglich, die eine bequemere und schnellere Abfertigung
der Reisenden verbürgt, und endlich konnte in begrenztem Umfang an
einige Bahnhofsbauten gedacht werden, die der Förderung der
Fahrtenzahl zugute kommen mußte..."
Auch wenn mit Statistiken und Durchschnittswerten sehr vieles und manchmal
auch das Gegenteil bewiesen werden kann, die folgenden Zahlen aus dem
Jahr 1929 sprechen eine deutliche Sprache über den ökonomischen Nutzen
der Elektrifizierung der Stadt-, Ring- Vorortbahnen.
Die Kosten in Reichspfennigen: ein Zugkilometer im Durchschnitt 324,3,
ein Zugkilometer im Dampfbetrieb 412,0, ein Zugkilometer im elektr. Betrieb
281,8, ein Platzkilometer im Durchschnitt 0,24, ein Platzkilometer im
Dampfbetrieb 0,40, ein Platzkilometer im elektrischen Betrieb 0,21,
eine Person im Durchschnitt 23,8, eine Person im Dampfbetrieb 36,5,
eine Person im elektrischen Betrieb 16,9.
Berliner S-Bahn-Museum GbR
|

