 |
Durch den Senatsbeschluß vom August 1991 ist die BVG verpflichtet worden,
10% ihrer Verkehrsleistungen beim Bus an private Unternehmen zu vergeben.
Anlaß dafür war die Hoffnung des Senats, bei der BVG Kosteneinsparung
ohne Leistungsabbau zu erzielen. Die IGEB hat bereits vor einem
Jahr Kriterien genannt, die aus Fahrgastsicht bei der Privatisierung
beachtet werden müssen (siehe SIGNAL 1/92 ). Inzwischen fahren in
Berlin auf mehr als einem Dutzend Buslinien und bei fast allen
SEV-Einsätzen private Unternehmen - Anlaß genug für eine
Zwischenbilanz aus Fahrgastsicht.
 |
| Kinderwagen? Nein Danke! Im Herbst 1992 erfolgte der Schienenersatzverkehr im Bereich Herzbergstraße z.T. mit Bussen die war wie Stadtlinienbusse aussahen, tatsächlich aber noch nicht einmal einen Kinterwagenplatz boten. Foto: Matthias Horth |
|
Der nach der Vereinigung politisch verschuldete
Personalmangel bei BVG/BVB (Stellenstop,
Entlassungen, Lohngefälle) und die Ankündigung,
die Senatszuschüsse an die BVG ab 1992
drastisch zu kürzen, führten zu einer überstürzten
Umstellung mehrerer Linien auf privaten
Busbetrieb, was für die BVG-Fahrgäste z.T. deutliche
Verschlechterungen brachte. Über die von
den privaten Firmen eingesetzten Busse, die zumeist
in anderen Städten gerade ausgemustert
wurden, konnte man dabei als Fahrgast gerade
noch hinwegsehen. Gravierender war es schon,
daß die Busse wegen unzureichender Kennzeichnung
und wegen der unzureichenden Beschilderung
kaum als Linienbusse zu erkennen waren.
Auch hatten die anfangs nur im Berufs- und Schülerverkehr
eingesetzten Busse für Kinderwagen
und Gepäck keinen Platz, und Fahrscheine konnten
nicht erworben werden. Die z.T. noch heute
eingesetzten Altfahrzeuge waren nicht in den
Betriebsfunk der BVG integriert, so daß die Wagen
dieser Linien noch nicht einmal in die - ohnehin
wenigen - Umsteigeanschlüsse z.B. in den
Abendstunden und im Nachtnetz eingebunden
waren bzw. sind. Und schließlich wurden zahlreiche
Busse eingesetzt, die für den Linienverkehr
völlig ungeeignet sind: So führte der Einsatz von
(Doppeldeck-) Reisebussen zu viel Verdruß bei
den Fahrgästen, und noch immer werden von den
privaten Unternehmen Busse eingesetzt, in denen
Fahrgäste mit Kinderwagen von der Beförderung
ausgeschlossen sind.
Reisebusse statt Schlenkis im SEV
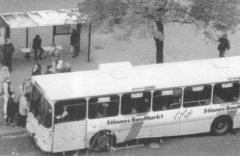 |
| Fehrbelliner Platz, BVG-Bus im Schülerverkehr der Linie 115. Das Beispiel zeigt, daß sich die Privatunternehmen inzwischen nur noch die Rosinen herauspicken, indem sie die Grundlast übernehmen, während die kostenträchtigen Berufsverkehrsfahrten bei der BVG verbleiben. Foto: Clemens Radke |
|
Aber für die gravierendsten Nachteile, die den
Fahrgästen aus dem Einsatz von Privatbussen
entstanden sind, war und ist die BVG selbst verantwortlich.
Dies betrifft z.B. den schon seit Ende
1991 praktizierten Einsatz von Privaten auf SEV-Linien.
Den durch Schienenersatzverkehr ohnehin
schon gebeutelten Fahrgästen wurden und
werden weiterhin die gerade hier völlig ungeeigneten
Doppeldeck-Reisebusse zugemutet. Seit
einigen Monaten werden ausschließlich normale
zweiachsige Standardbusse eingesetzt (auch diese
z.T. ohne Mitnahmemöglichkeit von Kinderwagen),
die dann Ersatz für einen Straßenbahnzug
mit 400 Plätzen bieten sollen. Gerade im
Kurzstreckenverkehr des SEV wären jedoch die
alten BVG-Ikarus-Schlenkis mit ihrer höheren
Kapazität und den vielen Türen besonders geeignet.
Keine Rollstuhlbeförderung
Aber auch an anderer Stelle bewies die BVG eine
unglückliche Hand. Noch im Juni 1991 veröffentlichte
die BVG ihr "Basisnetz" für Behinderte, das
mit den Behindertenorganisationen abgestimmt
war. Es beinhaltete u.a. die Buslinien 180,183 und
188, die zu diesem Zeitpunkt auch vollständig mit
rollstuhlgerechten BVG-Bussen bestückt waren.
Warum aus der Vielzahl der möglichen Linien
nun ausgerechnet auch diese Buslinien zur Privatisierung
ausgesucht wurden und folglich die
Beförderung von Rollstühlen von heute auf morgen
- ohne Information der Öffentlichkeit und
entgegen den Angaben im Kursbuch - wieder
entfiel, bleibt das Geheimnis der Verantwortlichen
bei der BVG.
 |
| Die Straßenunterführung in der Steglitzer Albrechtstraße ist jetzt für Doppeldecker zugelassen. Die BVG hat jedoch im Rahmen der Privatisierung verträglich sichergestellt, daß sich die Fahrgäste auch weiterhin in (zweiachsigen) Eindeckern drängeln müssen. Foto: Matthias Horth |
|
Inzwischen verfügen die Privatunternehmen jedoch
zunehmend über neue Fahrzeuge, die denselben
Standard wie neue BVG-Busse bieten (z.B.
Niederflurbauweise mit Hublift, Entwerter,
Zielschilder, BVG-Betriebsfunk, BVG-Farbgebung)
und zu deren schnellstmöglicher Beschaffung sich
die Unternehmer verpflichten mußten. Und so
dürften eine Reihe von Problemen, die den Fahrgästen
aus dem überstürzten Einsatz von Privatbussen
entstanden sind, hoffentlich bald der Vergangenheit
angehören.
Bleibender Ärger in Steglitz
Bleibenden Ärger wird den Fahrgästen in Steglitz
jedoch die BVG-Entscheidung über die Auswahl
der zu privatisierenden Buslinien und den dazugehörigen
Wageneinsatz bereiten: Millionensummen
wurden verbaut, und jahrelang wurden den
Fahrgästen der Wannseebahn Unannehmlichkeiten
zugemutet, damit die S-Bahn-Brücke über der
Albrechtstraße zugunsten des dringend erforderlichen
Einsatzes von Doppeldeckbussen auf den
regelmäßig überfüllten Bussen der Linien 180,
183 und 283 möglich wurde. Aber fast zeitgleich
mit der Freigabe der Brückendurchfahrt für Doppeldecker
ging die BVG vertragliche Bindungen
mit Privatunternehmen ein, die den Einsatz von
(zweiachsigen) Eindeckbussen auf den Linien 180
und 183 auf Jahre festschreiben. Auch der auf anderen
Buslinien (115, 132) inzwischen praktizierte
Einsatz von privaten Gelenkbussen, deren
Einsatz auch auf den vorgenannten Linien möglich
wäre, ist damit ausgeschlossen. Besonders
ärgerlich ist daran, daß den Fahrgästen nicht nur
weiterhin die zeitweise völlig überfüllten Standard-Eindeckbusse
zugemutet werden, sondern
hier auch durch den Einsatz größerer Fahrzeuge
ein wirtschaftlicherer Betrieb möglich wäre, ohne
daß den Fahrgästen gravierende Nachteile entstünden.
Zwischenbilanz für Fahrgäste
 |
| Einsteigen erlaubt. Das fahrgastfreundliche, hier auf der Privatlinie 115 praktizierte Offenhalten der Türen während der Pausen an den Endhaltestellen kann einem inzwischen auch bei BVG-Fahren passieren. Foto: Matthias Horth |
|
Trotz all dieser Probleme: Der Einsatz privater
Busse im BVG-Linienverkehr hat für die Benutzer
auch positive Auswirkungen gehabt. Bei aller
Vorsicht, die man bei solchen Verallgemeinerungen
walten lassen muß, scheint der Anteil der
freundlichen und zugunsten der Fahrgäste mitdenkenden
Fahrer bei den Privaten etwas höher zu
sein. So muß man als Fahrgast bei den privaten
Bussen an der Endhaltestelle häufig nicht mehr
in Regen stehen bleiben, und bei schon geschlosen
Wagentüren besteht eine etwas größere
Chance, doch noch mitfahren zu können. Auch
die BVG ist mit dem Betrieb der privaten Unternehmen
insgesamt zufrieden, wenn man von einigen
unrühmlichen Ausnahmen absieht. So wurde
z.B. dem mit der Bedienung der Linie 106 ab
Sommerfahrplan '92 beauftragten Privatunternehmen
bereits zum 14. Juli 1992 wieder gekündigt,
nachdem es mehrfach zu Unregelmäßigkeiten und
Fahrtausfällen gekommen war. Seitdem werden
die Touren der Buslinie 106 von mehreren Privatunternehmen
gefahren.
Spart die Stadt wirklich?
Neben den inzwischen eher positiven Alltagserfahrungen
mit dem Einsatz der Privaten ist die
wirtschaftliche Bewertung weniger eindeutig.
Denn Während zunächst nur Verkehrsleistungen
privatisiert worden sind, die für die BVG außerordentlich
kostenintensiv waren, droht sich dies
inzwischen ins Gegenteil zu verkehren.
Verkehrsleistungen sind für die BVG insbesondere
dann teuer, wenn z.B. für die morgendlichen
Spitzenstunden, in denen sich Berufs- und Schülerverkehr
überlappen, extra Fahrzeuge vorgehalten
werden müssen, die nur für diese kurze Zeit
benötigt werden. Dabei müssen natürlich die gesamten
Infrastrukturkosten für den Einsatz des
Busses wie Lohn-, Werkstatt- und Verwaltungskosten
berücksichtigt werden. Nach Angaben in
der Mitarbeiterzeitschrift BVG-Signal können die
Kostensätze der privaten Unternehmen bei diesen
Verkehren um bis zu 3 DM pro Wagenkilometer
unter denen der BVG liegen. So sparte die BVG
seit dem 3. Februar 1992 allein durch die Vergabe
der "Spitzenkurse" auf den Linien 111, 131,
132, 134 und 135 allein 13 Fahrzeuge und damit
jährlich etwa 400.000 DM Betriebskosten ein.
Aber auch im normalen Betrieb können die Privatunternehmen
preiswerter fahren, nicht nur weil
sie ihren Betrieb effizienter organisieren können
als der Eigenbetrieb, sondern auch weil sie weniger
Personal für dieselbe Verkehrsleistung brauchen,
obwohl auch sie zur Bereithaltung einer
Einsatzreserve verpflichtet sind. So benötigen die
Privatunternehmen bei unveränderten Fahrplänen
praktisch auf allen privatisierten (Tages-)Buslinien
weniger Fahrzeuge und entsprechend weniger
Personal als zuvor die BVG. Dies liegt nicht
etwa nur an betriebsinternen Regelungen der jeweiligen
privaten Auftragnehmer, wie Senator
Haase kürzlich in der Antwort zu einer Kleinen
Anfrage schrieb, sondern vor allem daran, daß die
Privatunternehmen "lediglich" an die Einhaltung
der gesetzlichen Pausenzeiten gebunden sind,
nicht aber an die spezifischen BVG-Regelungen.
die die Anrechnung der für einen wirtschaftlichen
Betrieb besonders wichtigen "Blockpausen" praktisch
ausschließen.
 |
| Beeindruckend vielfältig ist die Beschilderung dieses Privatbusses im Schienenersatzverkehr für die U2 (März 1992) Foto: Marc Heller |
|
Es lassen sich also durch den Einsatz von Privatunternehmen
tatsächlich Kosten einsparen, ohne
daß das Angebot reduziert oder Leistungen
schlechter werden müssen. So wird die BVG ca.
750 Mitarbeiterstellen einsparen können, ohne
daß Entlassungen vorgenommen werden. Ob jedoch
das nach Abzug der Mietkosten ermittelte
Sparvolumen von 20 bis 25 Mio. DM pro Jahr
erreicht werden kann, muß inzwischen bezweifelt
werden, denn die privaten Busunternehmen
wissen inzwischen um ihre starke Position. Durch
die verbindliche politische Vorgabe zur Privatisierung
eines Quantums von 10% der BVG-Busverkehrsleistungen
ist "der Markt" praktisch außer
Kraft gesetzt worden.
Die privaten Unternehmen nutzen den Privatisierungsdruck,
unter dem die BVG steht, und bestimmen
damit letztlich nicht nur den Preis, sondern
vor allem auch die Bedingungen. Seit einiger Zeit
übernehmen sie fast nur noch die kontinuierliche
"Grundlast", d.h. das besonders kostenträchtige
Fahren einzelner Umläufe z.B. im Berufsverkehr
verbleibt auf immer mehr Linien bei der BVG.
Tendenziell wird somit der durchschnittliche Preis
für den Wagenkilometer bei der BVG deutlich
steigen und die Spanne zum privat gefahrenen
Wagenkilometer immer größer werden. Der tatsächliche
Einspareffekt wird wegen der überstürzten
politischen Vorgabe, der in auch die
Fahrgäste viele Unannehmlichkeiten zu verdanken hatten,
immer kleiner. Nur eine modifizierte politische
Vorgabe, die den Handlungsspielraum
der BVG erhöht (z.B. Privatisierung nur,-
wenn BVG und Fahrgästen keine Nachteile
entstehen) und die zur Wiederherstellung von
Marktbedingungen beiträgt (z.B. Berücksichtigung
von Unternehmen aus dem Umland),
kann daran etwas ändern. IGEB
|

