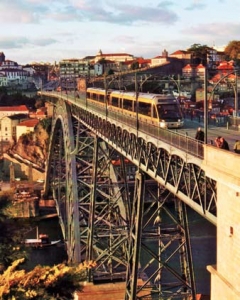 |
| Während die Berliner Verkehrsplanung den Straßenbahnausbau mehr bremst als beschleunigt, haben andere europäische Großstädte die Vorteile der Straßenbahn längst erkannt. So wurde z. B. in Portugals zweitgrößter Stadt Porto der Autoverkehr von der prominentesten Brücke über den Fluss Douro zugunsten einer neuen Straßenbahntrasse verbannt. Fotos: Matthias Horth |
|
In Teil I (SIGNAL 5/2008) war dargelegt worden,
dass die Straßenbahn das Verkehrsmittel
der Zukunft ist und ihr Ausbau deshalb
endlich auch in Berlin mehr Gewicht erhalten
muss – politisch und planerisch. Derzeit
beherrscht die Finanzkrise die politischen
Debatten. Dabei wird oft verkannt, dass
wir uns nicht nur in einer Finanz-, sondern
auch in einer Strukturkrise befinden. Soll
ein ökonomischer wie ökologischer Kollaps
der Industriegesellschaften vermieden werden,
muss auf nachhaltige Systeme gesetzt
werden, wobei natürlich immer auch die
sozialen Strukturen zu beachten sind. Was
so recht abstrakt klingt, soll hier in Teil II am
Beispiel der Berliner Straßenbahn veranschaulicht
werden.
Neben übergeordneten Gründen sind richtungsweisende
Entscheidungen pro Tram in
Berlin auch deshalb erforderlich,
weil das
jetzige Netz verschiedene Mängel aufweist,
die einen wirtschaftlichen Betrieb der Elektrischen
teilweise behindern. Viele sind noch
immer eine Folge der jahrzehntelangen Teilung
Berlins und einer Verkehrspolitik, die zur
vollständigen Abschaffung der
Straßenbahn
in West-Berlin und im südlichen Bereich der
Ost-Berliner Innenstadt führte.
Auch heute noch scheint der Berliner Senat
die Bedeutung der Tram als Umwelttechnologie
zu unterstützen. Wie sollen denn
die Klimaschutzziele erreicht werden, wenn
jede Ausbaumaßnahme im Bereich der
Straßenbahn allenfalls im Schneckentempo
vorankommt?
Maßnahmen im Bestandsnetz
Der Berliner Senat sollte mehr darauf achten,
dass die BVG die im Verkehrsvertrag vereinbarten
Leistungen (auch) bei der Straßenbahn
überhaupt erbringt. Nicht erbrachte
Verkehrsleistungen waren bereits in SIGNAL
2/08 ein Thema. So etwas darf nicht mehr
vorkommen! Ebenso sollte die BVG stärker in
die Pflicht genommen werden, das Erscheinungsbild
der Züge zu verbessern und auf
angemessene Sitzplatzkapazitäten zu achten.
„Fahrende Müllkippen“, in denen die Fahrgäste
in Kurzzügen zusammengepfercht werden,
widersprechen einem Unternehmen mit
Dienstleistungsanspruch schon im Ansatz.
Erfreulicherweise scheint sich die BVG
jetzt (wieder) stärker auf die Tram zu besinnen.
So machte sie zur Taktverdichtung
der M 2 eine intensive Öffentlichkeitsarbeit.
Und sie will verstärkt gegen Vandalismus
(zerkratzte Scheiben) vorgehen. Für
die zwischenzeitlich einstellungsbedrohte
Uferbahn, die Linie 68, verspricht die BVG
eine bessere Vermarktung. Ein guter Anfang,
doch es darf nicht bei solchen Einzelmaßnahmen
bleiben.
Vorrangschaltungen für die Tram
Der Senat wiederum ist aufgerufen, die
Beschleunigung der Tram an Ampelanlagen
zu verbessern bzw. wiederherzustellen.
Es ist ungeheuerlich, dass teilweise für
viel Geld geschaffene Vorrangschaltungen
zugunsten des Autoverkehrs und zulasten
der Straßenbahn still und heimlich außer
Betrieb genommen wurden. Minutenlange
Aufenthalte wie z. B. auf der M 2 auf dem
letzten Abschnitt zum Alexanderplatz sind
nicht hinnehmbar. Immerhin sicherte der
Senat inzwischen zu, auf der Osloer Straße
wieder mehr Vorrangschaltungen für die
Elektrische einzurichten.
 |
| In den französischen Städten weis man die Straßenbahn nicht nur als modernes und attraktives Verkehrsmittel zu schätzen, sondern setzt sie auch bewusst als Element der Stadterneuerung und zur Stärkung der Innenstädte ein. In Mulhouse (Mühlhausen) wird die Straßenbahn in Kürze nach Karlsruher Vorbild auf Eisenbahnstrecken weit in die Region hinaus fahren. Foto: Matthias Horth |
|
Bei Stadtentwicklungs- und Bebauungsplänen
ist die Tram stärker zu berücksichtigen.
Die derzeit vergleichsweise eher schwach ausgelastete
Linie 21 beispielsweise durchquert
auf der Köpenicker Chaussee eine Gegend
mit Grundstücken, die teilweise direkt an der
Spree liegen und deren Wert spätestens mit
der Anbindung an den umgebauten Bahnhof
Ostkreuz deutlich zunehmen wird. Was liegt
da näher, als hier die Ansiedlung weiterer
Wohnhäuser und Betriebe mit hohen Arbeitnehmerzahlen
zu fördern – denen sogleich
eine Straßenbahnanbindung zugute kommt?
Die fertig gestellten neuen Häuser entlang
der 21 scheinen bereits dazu beizutragen, die
Nachfrage abschnittsweise zu steigern.
Bei konsequenter Umsetzung einer vorausschauenden
Stadt- und Verkehrsplanung
können „schwache“ Straßenbahnlinien
„stark“ werden. Den leidigen Diskussionen
um angeblich unwirtschaftliche Strecken
wäre der Boden entzogen.
Bei einer Reihe von Strecken würden schon
einzelne, eher geringfügige Maßnahmen
ausreichen, um die Nachfrage zu verbessern.
So müsste beispielsweise auf der Linie 62 im
Bereich des nördlichen Hultschiner Damms
abschnittsweise ein zweites Gleis verlegt
werden, um einen 10-Minuten-Takt zu ermöglichen.
An verschiedenen Stellen Berlins
würden sich überfahrbare Haltestellen-Kaps
anbieten, um den Zugang der Fahrgäste zu
den Straßenbahnzügen zu verbessern.
Neue Fahrzeuge
Die Beschaffung neuer Fahrzeuge ist natürlich
zu begrüßen und die Resonanz auf die
Vorstellung der Prototypen von „Flexity Berlin“
war beeindruckend. Die BVG feierte die
Züge mit einem regelrechten Volksfest und
sogar Finanzsenator Thilo Sarrazin ließ sich
mit einem Modell der neuen Tram ablichten.
Der Andrang bei den ersten Mitfahrmöglichkeiten
im September 2008 war enorm.
Wie kundenfreundlich und funktionssicher
die Flexities aber tatsächlich sind, wird sich
erst im harten Alltagsbetrieb zeigen. Hier
ist jeder Fahrgast gefragt, seine Beobachtungen
einzubringen. Die Flexities werden
auch neuen Anforderungen gewachsen sein
müssen, wie zum Beispiel der verstärkten
Mitnahme von Fahrrädern.
 |
| Straßenbahn mit maritimen Design: Schon in den 1990er Jahren erkannte man in der französischen Hafenstadt Marseille, dass der U-Bahn-Ausbau nicht mehr finanzierbar ist und entschied sich für ein modernes Straßenbahnsystem. Foto: Matthias Horth |
|
Allerdings erscheint es problematisch,
lediglich Fahrzeuge mit einer Breite von
2,40 m anzuschaffen, die auf vielen Strecken
nicht eingesetzt werden können. Die BVG
verschärft mit dieser Auswahl die Problematik
eines „Zwei-Klassen-Straßenbahnnetzes“,
da auf den Strecken mit geringerem Gleismittenabstand
die modernsten Züge künftig
nicht sofort zum Einsatz gelangen können.
Um die Zwänge zum Umbau von Straßenbahnlinien
oder gar zur Stilllegung von
Strecken zu vermeiden, bietet es sich an, zusammen
mit der Stadt Potsdam zusätzlich
Trambahnzüge mit einer Breite von 2,30 m
zu beschaffen bzw. ein Fahrzeugtausch-System
zu entwickeln.
Neue Züge sollten außerdem unbedingt
mit Energiespeicher-Systemen ausgestattet
werden, um den Stromverbrauch zu reduzieren.
Die Straßenbahn in Mannheim macht
dies bereits vor. Speichersysteme könnten
auch stationär entlang der Strecken installiert
werden (siehe SIGNAL 6/2007, Seite 26).
In Hannover gibt es bereits Erfahrungen mit
dieser Lösung.
Kürzlich hat die Firma Bombardier ein
neues System namens „Primove“ vorgestellt,
bei dem die Straßenbahnfahrzeuge
den Fahrstrom aus Unterflur-Leitungen
beziehen können. Sofern es sich bewährt,
dürften der Bau und der Betrieb von Straßenbahnstrecken
noch kostengünstiger
werden, da Oberleitungen dann nicht mehr
bzw. nicht mehr für das gesamte Netz erforderlich
wären. Zudem soll „Primove“ helfen,
Energie zu sparen. Es bleibt zu hoffen, dass
„Primove“ verlässlicher funktioniert als die
Unterflur-Stromzuführung der Straßenbahn
in Bordeaux, wo diese Technik gelegentlich
Probleme bereitet.
Die genannten Beispiele zeigen, welche
großen Entwicklungspotenziale die Straßenbahn
hinsichtlich Baukosten, Energieeinsparung
und Stadtverträglichkeit noch
immer bietet.
Unfälle vermeiden
Leider hat es in Berlin 2008 wieder einige
schwere Unfälle im Bereich der Straßenbahn
gegeben. Einige Menschen starben dabei
oder wurden schwer verletzt. Obgleich die
Versäumnisse immer auf Seiten der Fußgänger
lagen und die Straßenbahn an sich ein
sehr sicheres Verkehrsmittel ist, muss das Thema
Unfälle sehr ernst genommen werden.
Um die Unfallzahlen gering zu halten,
muss schon bei der Verkehrserziehung
(nicht nur von Kindern) deutlicher auf die
Gefahren hingewiesen werden, die beim
Überschreiten von Gleisanlagen bestehen.
Konstruktive Lösungsansätze anderer Städte
zur Unfallvermeidung sollten in Berlin
geprüft werden. So wurden in Nantes bei
Kreuzungen mit dem eigenen Bahnkörper
der Tram spezielle Zweikammer-Blinksignale
eingeführt, die zur besseren Sichtbarkeit
für Pkw-Fahrer in niedriger Höhe montiert
sind. In Karlsruhe hat man Blinklichter in
den Belag von Fußgängerüberwegen an einer
Haltestelle eingelassen, die auch die unaufmerksamen
Walkmanträger erreichen, die ihren Kopf nicht mehr
zur Ampel heben. In beiden Fällen wurde
eine deutliche Senkung der Unfallzahlen
bzw. der Nichtbeachtung der Verkehrslage
erreicht.
Soweit das leise Fahren von Straßenbahnen
für Unfälle bedeutsam ist, stellt sich
diese Problematik natürlich auch
bei anderen leisen Verkehrsmitteln.
Werden uns in Zukunft vielleicht
horrende Unfallzahlen
durch Elektroautos beschäftigen?
Netzausbau
Beim Netzausbau muss der Schwerpunkt
auf Streckenverlängerungen Richtung
Westen gelegt werden, denn mehr als bei
jedem anderen Verkehrsmittel sind bei der
Straßenbahn die Folgen der Teilung Berlins
zu spüren.
Der Berliner Senat möchte seine Entscheidungen
zum Ausbau des Straßenbahnnetzes
von einer neuen Verkehrsprognose
abhängig machen – eine zweischneidige
Angelegenheit. Zum einen sind solche
Prognosen
natürlich wichtig, um Fördermittel
zu erhalten, andererseits befinden sich
die ökonomischen, ökologischen und sozialen
Grundlagen der Industriegesellschaften
derzeit so sehr im Umbruch, dass sich künftige
Entwicklungen nur bedingt abschätzen
lassen.
In jedem Fall ist es unerlässlich, Planung
und Bau von Straßenbahnstrecken in Berlin
zu beschleunigen. Damit das gelingen kann,
muss der entsprechende Arbeitsbereich der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
über mehr und neue Fachleute verfügen.
Mittel- bis längerfristig „rechnen“ sich die
Mehrkosten durch ein effizienteres Straßenbahnnetz.
Darüber hinaus schafft jeder Ausbau
der Tram Arbeitsplätze, und zwar hier in
der Region.
Welche Strecken im Westteil Berlins „straßenbahnwürdig“
sind, ist schon in vielen
Beiträgen beschrieben worden. Angesichts
knapper Finanzmittel wird das westliche
Straßenbahnnetz zwangsläufig ein solches
sein, das sich auf nachfragestarke Achsen
konzentriert. An vielen Orten versprechen
bereits relativ kurze Neubaustrecken hohe
Fahrgastzahlen, zum Beispiel vom Virchow-
Klinikum zum S-Bahnhof Beusselstraße oder
vom S-/U-Bahnhof Warschauer Straße zum
Hermannplatz. Letztere Verbindung ist vor
allem deshalb wichtig, weil sich von Neukölln
her stärkere Verkehrsströme Richtung
Friedrichshain entwickeln dürften
(siehe SIGNAL 4/08).
Die Verknüpfung der Tram
mit U7/U8 am Hermannplatz würde eine herausragende
Bedeutung haben. Neue Straßenbahnstrecken
bringen stets auch neue
Kunden für den öffentlichen Verkehr.
„Leuchtturm-Projekte“ wichtig
Zwei Straßenbahnprojekte sind insoweit
in besonderem Maße bedeutsam, weil sie
nicht nur eine jeweils hohe Nachfrage versprechen,
sondern auch die Möglichkeiten
bieten, städtebauliche Akzente zu setzen.
Gemeint sind die Strecken zum Potsdamer
Platz und weiter nach Steglitz sowie Richtung
Moabit bzw. Charlottenburg.
Bei dem Straßenzug Potsdamer Straße,
Hauptstraße, Rheinstraße, Schloßstraße
handelt es sich bekanntlich um eine außerordentlich
lange Geschäftsstraße, die außerdem
noch eine verdichtete Wohnbebauung
aufweist. Somit ist ein leistungsfähiges Verkehrsmittel
gefragt, das im Straßenraum auf
Blickhöhe an den Geschäften entlang fährt,
aber nicht von den zur Belieferung auf der
Fahrbahn haltenden Lkw aufgehalten wird,
hohe Fahrgastzahlen bewältigen kann und
auch die Kunden berücksichtigt, die mit
Einkaufstüten oder mit Kinderwagen unterwegs
sind.
Dass eine
Straßenbahn von Berlin-Mitte nach Steglitz
machbar ist und für die Fahrgäste,
aber auch für die Stadtentwicklung
insgesamt viele Vorteile und Chancen bietet,
wurde ja bereits in SIGNAL 5/08 (Seite 10)
von Studierenden der TU Berlin überzeugend
dargelegt. Ihre Arbeit ist inzwischen
im Internet verfügbar (unter
busersatzverkehr.de).
Umso unbegreiflicher ist es, dass der Berliner
Senat dieses wichtige Straßenbahnprojekt
durch die Errichtung eines „Boulevard
der Stars“ auf der künftigen Tramtrasse am
Potsdamer Platz blockieren will (siehe Seite
7 in diesem Heft). Würde sich der Senat so
verhalten, wenn es um eine Trassenfreihaltung
für Straßenbau geht?
Das zweite „Leuchtturm-Projekt“ ist eine
Verlängerung der Straßenbahn Richtung
Moabit bzw. ins nördliche Charlottenburg.
Im Zusammenhang mit der Weiterführung
zum Hauptbahnhof wird M 10 zum Wenden
bis zur Invalidenstraße Ecke Alt-Moabit verkehren.
Warum wird sie dann nicht gleich
zum U-Bf Turmstraße verlängert, besser
noch bis zur Beusselstraße? Dass sich Moabit
angesichts seiner Kiezstruktur für ein
Straßenbahnnetz besonders gut eignet, ist
nahe liegend und war schon Gegenstand
verschiedener verkehrswissenschaftlicher
Untersuchungen.
Derzeit laufen Planungen, die Turmstraße
(auch) als Einkaufsstraße attraktiver zu
machen – hierfür ist die Tram schlichtweg
unerlässlich, braucht doch eine solche Straße
eine gute Verkehrserschließung nicht
nur aus praktischen Gründen, sondern auch
als Symbol. Würde die Tram dauerhaft am
Hauptbahnhof enden, wäre dies für die
Turmstraße von außerordentlichem Nachteil:
Vom Hauptbahnhof Richtung Osten
bestünde eine gute Verbindung per Tram,
Richtung Westen das weniger attraktive
Busangebot, reduziert auch noch
um den TXL-Bus, sobald der Flughafen
Tegel geschlossen ist.
Die künftige Nutzung des Flughafengeländes
Tegel spielt auch für den
Ausbau der Tram eine Rolle. Sollte sich
Berlin für Nutzungen mit Verkehrsbedarf
entscheiden, ließe sich die Straßenbahn
von Moabit Richtung Nordwesten
ansprechend auf Rasengleisen
in neue Wohn-, Gewerbe- bzw.
Ausflugsgebiete führen. Wohnen
und Einkaufen in Moabit, Abfahren
in die weite Welt am Hauptbahnhof,
Kulturprogramm am Hackeschen
Markt, Erholung am Badesee und im
vergrößerten Stadtforst Jungfernheide
– eine Straßenbahnlinie würde es
möglich machen, dies alles ohne Umsteigen
zu erreichen!
Weitere Projekte
Im Norden Berlins ist die Herstellung
einer Straßenbahntangente
Wilhelmsruher Damm—Kurt-Schumacher-
Damm—Bf Jungfernheide
anzustreben, wenngleich diese Relation
im Bereich der Hinckeldeybrücke
einen ziemlich hohen Bauaufwand
erfordert. Zeitnah realisierbar ist die
erste Ausbaustufe mit einer Verlängerung
der M 1 von Pankow-Rosenthal
zum S-/U-Bahnhof Wittenau/Nordbahn.
Das Märkische Viertel erhielte
so endlich seinen direkten Anschluss
an den Schienenverkehr, außerdem
würden die S- und U-Bahn-Linien
des Bezirks Reinickendorf von einer
solchen Querverbindung profitieren
(Netzeffekt).
Auch im Süden Berlins sollte bei
allen Planungen eine Straßenbahntangente
planerisch berücksichtigt
werden und die heutige Buslinie M 11
ersetzen. Als erste Ausbaustufe sollte
der Abschnitt von Schöneweide zur
Gropiusstadt (U-Bf Zwickauer Damm
bzw. U-Bf Johannisthaler Chaussee)
realisiert werden.
Langfristig könnte diese Straße
von Dahlem Richtung Norden nach
Charlottenburg verlängert werden,
wodurch auch Schmargendorf besser
mit öffentlichen
Verkehrsmitteln
erschlossen wäre.
Vorbild dieser Überlegungen
ist der Ballungsraum
Paris, wo
ebenfalls ringförmig
um die Innenstadt
Straßenbahnlinien
geplant sind bzw. abschnittsweise
bereits
verkehren.
Was ein künftiges
Straßenbahnnetz in
Spandau betrifft, so
müsste geklärt werden,
ob es zunächst
als Separatnetz
aufgebaut werden
kann. Ggf. ließe sich
der jetzige Busbetriebshof
Spandau
künftig auch für die
Straßenbahn nutzen.
Hakenfelde, das
Falkenhagener Feld
und die Siedlungen
an der nordwestlichen
Heerstraße
jedenfalls bedürfen
einer Anbindung an
die Tram. Der jetzige
M 37 mit seinen
sehr kurzen Takten
und seinem hohen
Fahrzeugaufwand
müsste eher gestern
als heute auf Straßenbahnbetrieb
umgestellt werden.
Sicherlich lassen sich diese und andere
wichtige Projekte zumeist nur
langfristig realisieren, doch mit Trassenfreihaltungen
und einigen Vorleistungen
(zum Beispiel Leitungsverlegungen,
wenn ohnehin gebaut wird)
ließe sich schon in Kürze beginnen.
Es gilt das alte Sprichwort: Wo ein
Wille ist, ist auch ein Weg! (hjb) IGEB Stadtverkehr
|

